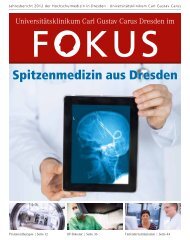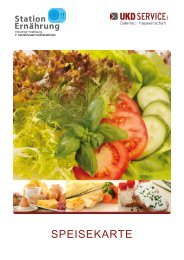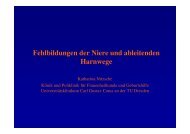DISSERTATIONSCHRIFT - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
DISSERTATIONSCHRIFT - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
DISSERTATIONSCHRIFT - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– E INLEITUNG –<br />
1.5.1 THEORETISCHER UND TECHNISCHER HINTERGRUND<br />
Das aus ca. 10 12 Neuronen bestehenden Gehirn erzeugt eine niederfreuquente nicht<br />
periodische Spannung, die an der Haut des Kopfes als Elektroenzephalogramm (EEG)<br />
ableitbar ist. Dieses Ruhe-EEG ist Folge der postsynaptischen exzitatorischen und<br />
inhibitorischen Potenziale von Neuronen. (Trepel 1999) Frequenz und Amplitude<br />
stellen die wichtigste Information des EEG dar. Die Amplituden der Spannungen im<br />
Spontan-EEG liegen normalerweise in einem Bereich von 10 bis 150µV. Der<br />
Wachheitsgrad des Patienten bestimmt die Frequenz der Spannungsänderung<br />
zwischen 1 und 40 Hz. Mittels des EEG ist es möglich so genannte ereigniskorrelierte<br />
Potenziale abzuleiten. Unter diesen versteht man die ortsspezifische<br />
Spannungsänderung auf Grund spezifischer Reize. Die ereigniskorrelierten Potenziale<br />
ermöglichen so die Darstellung der Art und Höhe der Spannungsänderung sowie des<br />
zeitlichen Zusammenhangs zum Reiz. Eine häufige Anwendung ist z.B. die Messung<br />
visuell, auditorisch und somatosensorisch evozierter Potenziale mit Hilfe von<br />
Lichtblitzen, akustischen „Clicks“ und elektrischen Hautreizen. Vorraussetzung zur<br />
Registrierung dieser auch s.g. evozierten Potenziale ist die Aktivierung hinreichend<br />
großer Neuronenverbände, so dass die Potenzialänderung aus dem Grundrauschen zu<br />
extrahieren ist. Für die genauere Einteilung und Analyse der erzeugten<br />
Spannungsänderungen existiert keine einheitliche Nomenklatur. Jedoch hat es sich<br />
durchgesetzt die Spezifika des evozierten Potenzials nach Polarität, Latenz und Ort der<br />
Ableitung einzuteilen. So ist es üblich positive Potenzialänderungen mit P, negative mit<br />
N und die Zeit der Latenz zum Ereignis mit einer Zahl zu bezeichnen. Beispielhaft<br />
bedeutet die Bezeichnung N400 eine negative Potenzialänderung 400ms nach dem<br />
Reiz. Für den Ort der Ableitung werden die Buchstaben Z für zentral, F für frontal, P für<br />
parietal, T für temporal und O für occipital verwendet. Die Abbildung 2 gibt einen<br />
Überblick über die gängigen Elektrodenpositionen.<br />
25