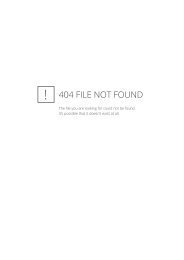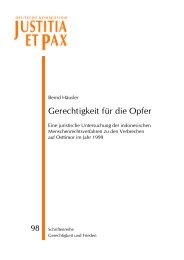Untitled - Justitia et Pax
Untitled - Justitia et Pax
Untitled - Justitia et Pax
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
lawien von Bedeutung, da er anfangs nur einen innerstaatlichen Charakter besaß und im<br />
Zuge der Konfliktentwicklung sich auch zu einem zwischenstaatlichen Konflikt wandelte.<br />
Während in zwischenstaatlichen Konflikten die Intervention nach den Regeln des Völkerrechts<br />
grundsätzlich zulässig ist, gilt das nicht für innerstaatliche Konflikte. Im Gegenteil<br />
dort ist die Intervention verboten und es gilt das Prinzip der “Nichteinmischung in die inneren<br />
Angelegenheiten“, um die Souveränität der Nationalstaaten zu schützen. Die Entstehung<br />
dieses Verbots geht auf die vielfältige mißbräuchliche Berufung auf ein Interventionsrecht<br />
bei innerstaatlichen Konflikten in der Geschichte zurück. Auf der anderen Seite<br />
ist aber auch zu beobachten, daß besonders diktatorisch organisierte Staaten zur Nichtbeachtung<br />
und Verl<strong>et</strong>zung der Menschenrechte sowie zur Unterdrückung von Minderheiten<br />
neigen und damit grundlegende Normen des humanitären Völkerrechts ignorieren,<br />
zugleich aber jedwede Einmischung von außen unter Hinweis auf das Interventionsverbot<br />
(Art. 2 UN-Charta) abweisen.<br />
Dieses Dilemma hat im Völkerrecht inzwischen einen Prozeß der Neubestimmung der<br />
nationalen Souveränität eingeleit<strong>et</strong>, an dessen Ende möglicherweise die Souveränität von<br />
Nationalstaaten immer dann eingeschränkt werden könnte, wenn sie innerstaatlich eine<br />
schwerwiegende und fortdauernde Verl<strong>et</strong>zung anderer Völkerrechtsnormen zulassen oder<br />
sogar selbst für deren Ausführung verantwortlich sind. Entscheidend ist dabei im Unterschied<br />
zu früher, daß nicht der einzelne Nationalstaat diese Regelverl<strong>et</strong>zungen feststellt<br />
und auf Abhilfe drängt, sondern zunehmend globale oder regionale Sicherheitsorganisationen<br />
wie UNO, OAS, OAU, KSZE, soweit sie dafür die Komp<strong>et</strong>enz besitzen, diese Aufgaben<br />
wahrnehmen. Z.B. hat die UNO grundsätzlich das Recht, im Falle einer regionalen<br />
friedensgeffihrdenden Situation zu intervenieren. Hat sie in der Vergangenheit eher bei<br />
einem aktuellen friedensgefährdenden (zwischenstaatlichen) Konflikt davon Gebrauch<br />
gemacht, so versucht sie dies zunehmend auch in einer potentiell friedensgefährdenden<br />
(innerstaatlichen) Situation, um regionalen Friedensgefährdungen vorzubeugen. Auch der<br />
KSZE-Prozeß und die Vereinbarungen des KSZE-Folg<strong>et</strong>reffens in Helsinki (1992) machen<br />
deutlich, daß die Einhaltung und Überwachung der Menschen- und Minderheitenrechte<br />
nicht mehr nur dem souveränen Nationalstaat obliegt.<br />
c) Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem Zusammenbruch seiner strukturbildenden<br />
Funktion für das internationale System ist sicherheitspolitisch eine neue Situation entstanden,<br />
für die die Nationalstaaten und die internationalen Sicherheitsorganisationen<br />
noch nach einer Lösung suchen. Im Grundsatz bi<strong>et</strong>en sich auch hier zwei Alternativen an.<br />
Die eine Alternative geht vom “System der Selbsthilfe“ aus, d.h., jeder Staat versucht seine<br />
Sicherheit primär nach eigenem Gutdünken zu organisieren und zu bewahren. Das<br />
21