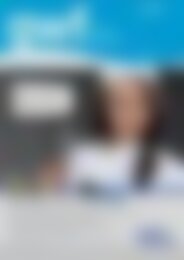gwf Wasser/Abwasser Energieeffizienz rechnet sich! (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Leitfähigkeit [Tsd. µS/cm]<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
nahme Artefakte durch eventuell innen an der Säulenwand<br />
entlang sickerndes <strong>Wasser</strong> zu vermeiden, wurden<br />
die Zapfhähne in das Innere der Säule hinein durch<br />
Edelstahl-Rohre verlängert, die am Ende verschlossen<br />
und im zentralen Bereich der Säule perforiert waren. Die<br />
Perforation wurde durch ein Siebgewebe mit 10 µm<br />
Maschenweite abgedeckt, um Auswaschung von<br />
Bodenpartikeln in die Probenahmeflaschen zu vermeiden<br />
(s. Bild 5).<br />
4. und 5. Tracerversuch 28.04. bis 20.05.2011 in den Modellsäulen<br />
(Ausgangssalzkonzentration 5.500 bzw. 4.900 µS/cm)<br />
Säule 1 Säule 2<br />
0,0<br />
27.04.11 02.05.11 07.05.11 12.05.11 17.05.11 22.05.11<br />
Bild 7. Durchbruchskurven der Salzlösung im Verlauf<br />
des 4. und 5. Tracerversuches charakterisieren die<br />
unterschied lichen Transportmechanismen in den Säulen.<br />
Tabelle 2. Vertikale Fließgeschwindigkeiten in den Säulen.<br />
Versuchsnummer Säule 1<br />
Fließgeschwindigkeiten<br />
Tracer 1<br />
Tracer 2<br />
Tracer 3<br />
Tracer 4<br />
Tracer 5<br />
0,0093 m/h<br />
2,2 m/d<br />
0,082 m/h<br />
1,97 m/d<br />
0,011 m/h<br />
0,26 m/d<br />
0,045 m/h<br />
1,07 m/d<br />
0,049 m/h<br />
1,17 m/d<br />
Säule 2<br />
Fließgeschwindigkeiten<br />
0,14 m/h<br />
3,36 m/d<br />
0,057 m/h<br />
1,37 m/d<br />
0,008 m/h<br />
0,20 m/d<br />
0,136 m/h<br />
3,30 m/d<br />
0,154 m/h<br />
3,70 m/d<br />
Säule 2<br />
Tabelle 3. Vertikale Durchlässigkeiten der Gesamtsäule in Funktion<br />
des Versuchszeitpunktes.<br />
Versuchsnummer Säule 1<br />
k f -Wert [m/s] ∙ 10 –5 k f -Wert [m/s] ∙ 10 –5<br />
Tracer 1 2,58 3,96<br />
Tracer 2 2,26 1,58<br />
Tracer 3 0,31 0,23<br />
Tracer 4 1,25 3,78<br />
Tracer 5 1,36 4,28<br />
Die Gesamthöhe des Aufbaus beträgt etwa<br />
4,50 Meter, wobei die Höhe des Untergestells rund<br />
0,50 Meter ausmacht. Dabei wurde der Bodenablass<br />
mit einer Siebplatte und einem 10 µm-Netzgewebe<br />
abgedeckt. Darüber wurden über einer Schicht Glaskugeln<br />
(∅ 1,55 bis 1,85 mm) die frisch am geplanten<br />
Standort des HFB erbohrten Sedimente in die Säulen<br />
eingebracht. Die schichtgerecht befüllten Säulen<br />
(Bild 6) wurden anschließend drucklos im freien Auslauf<br />
mit <strong>Wasser</strong> aus der Förderung des <strong>Wasser</strong>werks so<br />
beaufschlagt, dass ständig ein Überstand über der<br />
obersten Sedimentschicht erhalten blieb, während die<br />
Bodenabläufe der Säulen ständig vollständig geöffnet<br />
waren.<br />
2. Tracerversuche<br />
Im Verlauf der Versuchsreihen wurden insgesamt fünf<br />
Tracerversuche durchgeführt. Dazu wurde eine hoch<br />
mit Salz aufkonzentrierte Lösung (Leitfähigkeit etwa<br />
5000 µS/cm) auf die Säule beaufschlagt und zur Versickerung<br />
gebracht. Am zentralen Auslauf der beiden<br />
Säulen im Boden der PE-Säulen wurde eine kontinuierliche<br />
Leitfähigkeitsmessung installiert. Damit konnten<br />
die Salzdurchbrüche in den Säulen im Halbstundentakt<br />
oder Stundentakt durchgehend gemessen werden. Eine<br />
Messung an den einzelnen Schichtausläufen wurde<br />
nicht durchgeführt, da die <strong>Wasser</strong>mengen zu Beginn<br />
und im Verlauf der Versuche sehr gering waren und vollständig<br />
für die mikrobiologischen Beprobungen zur<br />
Verfügung stehen sollten.<br />
Bild 7 zeigt beispielhaft die Tracerdurchgangskurven<br />
für den 4. und 5. Tracerversuch. Bei den Tracerversuchen<br />
wurden Salzlösungen mit im Mittel rund<br />
5000 µS/cm Ausgangskonzentration eingegeben. Die<br />
Eingabe erfolgte simultan in den beiden Säulen durch<br />
Zugabe der Lösung in den Freibordbereich der Säule 1<br />
über der Glaskugelschicht bzw. über der Schotterschicht<br />
in der Säule 2 (s. Bild 6). Die vertikale Fließstrecke<br />
des <strong>Wasser</strong>s betrug etwa 3,85 m. Tabelle 2 fasst<br />
die vertikalen Fließgeschwindigkeiten, Tabelle 3 die<br />
vertikalen Durchlässigkeiten der Säulenschichtenfolge<br />
zusammen.<br />
Vergleicht man die Abstandgeschwindigkeiten der<br />
letzten beiden Versuche in den Säulen, dann ergeben<br />
<strong>sich</strong> durchschnittliche Werte von 1,12 m/d für Säule 1<br />
und 3,50 m/d für Säule 2. Der Geschwindigkeitskontrast<br />
zwischen der Säule 2 und 1 beträgt somit 1,8 für alle<br />
Versuche und 3,1 für die Versuche 4 und 5. Im Vergleich<br />
dazu betrug die horizontale Fließgeschwindigkeit aus<br />
den Pumptests in einem bereits realisierten HFB rund<br />
1,1 bis 1,6 m/d. Aus Tabelle 3 ergibt <strong>sich</strong> ein durchschnittlicher<br />
Durchlässigkeitsbeiwert für die vertikale<br />
Durchströmung der 3,85 m langen Sandsäule von<br />
1,55 ∙ 10 –5 m/s für die Säule 1 und von 2,78 ∙ 10 –5 m/s für<br />
die Säule 2. Aufgrund der vereinfachten Gradientenannahme<br />
ergeben <strong>sich</strong> im Vergleich die gleichen Faktoren<br />
November 2011<br />
1062 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>