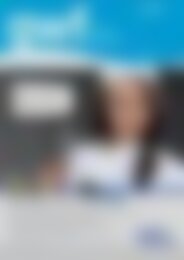gwf Wasser/Abwasser Energieeffizienz rechnet sich! (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
4.4.1 Adsorption<br />
Festbett-Adsorptionsverfahren sind für die Spurenstoffentfernung<br />
besonders geeignet, da sie bei richtiger Auslegung<br />
lange Standzeiten bei gleichzeitig hoher<br />
Betriebs<strong>sich</strong>erheit und geringem Wartungsaufwand<br />
ermöglichen. Zur Arsenentfernung kommen granulierte<br />
Adsorbentien auf Basis von Metalloxiden/-hydroxiden<br />
zum Einsatz [4]. In Deutschland sind die folgenden<br />
Adsorbentien zugelassen: Eisen(III)hydroxidoxid nach<br />
DIN EN 15029, eisenumlagertes, aktiviertes Aluminiumoxid<br />
nach DIN EN 14369 und aktiviertes, granuliertes<br />
Aluminiumoxid nach DIN EN 13753. In der Praxis hat <strong>sich</strong><br />
gezeigt, dass Eisenoxide/-hydroxide ein wesentlich<br />
höheres Adsorptionsvermögen aufweisen als Aluminiumoxid.<br />
Während des Betriebes erschöpft <strong>sich</strong> das<br />
Adsorptionsmaterial allmählich und muss vor Erreichen<br />
des Grenzwertes im Produktwasser gegen frisches Material<br />
ausgetauscht werden. Eine Reihenwechselschaltung<br />
zweier Adsorber erhöht die Betriebs<strong>sich</strong>erheit.<br />
Die erzielbare Adsorptionskapazität hängt von den<br />
Eigenschaften des Adsorbens (z. B. spezifische Oberfläche)<br />
und von den Rohwasserparametern ab. Ein<br />
geringerer pH-Wert und eine geringe Konzentration<br />
konkurrierender Anionen, insbesondere Phosphat,<br />
führen zu langen Standzeiten der Adsorptionsfilter. Bei<br />
der Auslegung der Festbettadsorber wird in der Regel<br />
von einer Filtergeschwindigkeit von 5 bis 15 m/h und<br />
einer Leerbettverweilzeit von 3 bis 10 Minuten ausgegangen.<br />
Nach vorliegenden Betriebserfahrungen werden<br />
bei Arsenkonzentrationen im Rohwasser von 10 bis<br />
50 µg/L, geringen Phosphat- und Silikatgehalten und<br />
pH-Werten unter 8,0 Beladungen von etwa 1 bis 10 g<br />
Arsen pro kg trockenes Adsorbens erreicht [5]. Beispielhaft<br />
sind drei typische Durchbruchskurven für ein im<br />
Trinkwasser zugelassenes Granuliertes Eisenhydroxid<br />
(GEH) in Bild 2 wiedergegeben.<br />
Bild 2. Arsen-Durchbruchskurven für Granuliertes Eisenhydroxid (GEH)<br />
aus drei verschiedenen <strong>Wasser</strong>werken [6].<br />
4.4.2 Flockung<br />
Bei der Flockung entstehen amorphe Niederschläge aus<br />
Eisen- oder Aluminiumhydroxid, die das Arsen adsorptiv<br />
binden. Die Dosiermengen des Flockungsmittels hängen<br />
von der spezifischen Rohwasserzusammensetzung<br />
ab, insbesondere vom pH-Wert sowie von der Arsenund<br />
Phosphat-Konzentration. In grober Näherung sollte<br />
die molare Fe(III) bzw. Al(III)-Konzentration mindestens<br />
das 10- bis 30-fache der molaren Arsenkonzentration<br />
betragen. Typische Dosiermengen liegen zwischen 0,5<br />
und 5 mg/L als Metallion [7]. Je niedriger der pH-Wert<br />
des Rohwassers ist, desto weniger Flockungsmittel wird<br />
benötigt bzw. desto geringer ist die Arsenkonzentration<br />
im aufbereiteten <strong>Wasser</strong>. Konkurrierende <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe,<br />
wie z. B. Phosphat, können eine Erhöhung der<br />
Flockungsmitteldosierung notwendig machen. Die Flockung<br />
mit Al(III)-Salzen ist gegenüber dem Einsatz von<br />
Fe(III) weniger effektiv und im pH-Bereich des Einsatzes<br />
eingeschränkt. Beide Flockungsmittel zeigen gegenüber<br />
Arsen(III) eine schlechtere Wirksamkeit, deshalb ist<br />
eine chemische Oxidation vor der Flockung erforderlich.<br />
Die Abtrennung der ausgefällten Hydroxide erfolgt<br />
in der Regel durch eine Schnellfiltration, wobei Durchbrüche<br />
besonders zu vermeiden sind (Arbeitsblatt<br />
W 213). Auch eine Verfahrenskombination mit der<br />
Mikrofiltration ist dazu geeignet, die Flocken abzutrennen.<br />
Hierbei ergibt <strong>sich</strong> der Vorteil, dass im Gegensatz<br />
zum herkömmlichen Flockungsverfahren die Ausbildung<br />
von Makroflocken nicht erforderlich ist.<br />
4.4.3 In-situ-Aufbereitung im Aquifer<br />
Unter der Voraussetzung eines geeigneten Eisen-Arsen-<br />
Verhältnisses im Rohwasser sowie guter hydrogeologischer<br />
Bedingungen kommt eine in-situ-Aufbereitung<br />
zur Arsenentfernung in Betracht. Dabei wird Arsen im<br />
Aquifer abgeschieden, analog zur subterrestrischen<br />
Enteisenung und Entmanganung [8].<br />
4.4.4 Entsorgung<br />
Bei den oben genannten Verfahren zur gezielten Arsenentfernung<br />
fallen feste oder schlammartige Rückstände<br />
an, die umweltverträglich und entsprechend den<br />
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden müssen.<br />
Aufgrund der selektiven Adsorption des Arsens an den<br />
Eisen- bzw. Aluminiumhydroxiden ist eine Elution unter<br />
normalen pH- und Redoxbedingungen nicht wahrscheinlich.<br />
Das beladene Material wird nicht regeneriert,<br />
sondern deponiert. Bei der Entsorgung von Aufbereitungsrückständen<br />
sind die DVGW-Arbeitsblätter<br />
W 221, Teile 1 bis 3, und W 222 zu beachten.<br />
5. Nickel<br />
Der Grenzwert der TrinkwV für Nickel wurde auf 20 µg/L<br />
festgesetzt. Da der Grenzwert am Zapfhahn gilt und da<br />
<strong>sich</strong> vornehmlich in der Hausinstallation die Konzen-<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1073