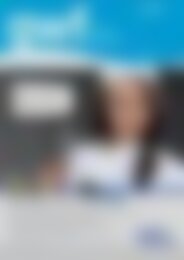gwf Wasser/Abwasser Energieeffizienz rechnet sich! (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
zwischen den Säulen wie bei der Abstandsgeschwindigkeit.<br />
Im Rahmen der Erkundungen wurde für den<br />
Brunnenstandort eine vertikale Durchlässigkeit von<br />
0,375 ∙ 10 –5 m/s bestimmt. Bezogen auf die Säule 1 liegt<br />
deren vertikale Durchlässigkeit um den Faktor 4,1 höher,<br />
bezogen auf die Säule 2 um den Faktor 7,4 höher als der<br />
Wert aus den in-situ-Pumptests.<br />
Anhand der ersten drei Versuche wird angenommen,<br />
dass es zu einer Kompaktion und Setzung des Säuleninhaltes<br />
im Versuchsablauf bei Durchströmung der Säule<br />
gekommen ist; in den Versuchen 4 und 5 wurde die<br />
Säule nach Einstau bzw. Leerlaufen wieder in Betrieb<br />
genommen, daher entspricht das Ergebnis dieser Versuche<br />
den Anfangsrandbedingungen. Mittlerer k f -Wert<br />
(vertikal) beträgt im Mittel der Versuchszeit für beide<br />
Säulen ca. 2 ∙ 10 –5 m/s. Die Relation k v /k fh,v beträgt in<br />
den Säulen rund 0,03; die Schichten in den Säulen sind<br />
somit in der resultierenden Durchlässigkeit um ca. eine<br />
Zehnerpotenz geringer durchlässig als bei den in-situ-<br />
Pumptests. Die horizontale Durchlässigkeit ist unter<br />
Annahme der Versuchsrandbedingungen etwa 30-mal<br />
höher als die vertikale Durchlässigkeit. Nach dem dritten<br />
Tracerversuch erreicht der Durch lässigkeitsbeiwert<br />
der Säulen den Prognosewert für den vertikalen Durchlässigkeitsbeiwert<br />
aus der Erkundung.<br />
3. Verwendete Testorganismen<br />
3.1 Escherichia coli<br />
Escherichia coli ist ein bewegliches, gram-negatives,<br />
stäbchenförmiges Bakterium, das keine Sporen bildet<br />
und peritrich begeißelt ist. Seine Größe beträgt rund<br />
1,3 · 4 µm. Es ist fakultativ anaerob, d. h., es ist in der<br />
Lage, Energie sowohl durch die Atmungskette als auch<br />
durch „Gemischte Säuregärung“ zu gewinnen.<br />
Escherichia coli kommt in hohen Konzentrationen in<br />
der Intestinalflora bei Mensch und Tier vor und löst dort<br />
in der Regel keine Erkrankung aus. In anderen Teilen des<br />
Körpers kann E. coli jedoch ernsthafte Erkrankungen wie<br />
Harnwegsinfektionen, Bakteriämien und Meningitis<br />
auslösen. Eine begrenzte Anzahl enteropathogener<br />
Stämme von E. coli kann eine akute Diarrhö auslösen.<br />
Unterschiedliche enteropathogene E. coli konnten auf<br />
der Basis unterschiedlicher Virulenzfaktoren einschließlich<br />
enterohämorrhagischen E. coli (EHEC), enterotoxigenen<br />
E. coli (ETEC), enteropathogene E. coli (EPEC),<br />
enteroinvasiven E. coli (EIEC), enteroaggregativen E. coli<br />
(EAEC) und diffus adhärente E. coli (DAEC) [1] unterschieden<br />
werden.<br />
E. coli gilt seit über 100 Jahren als der klassische Indikator<br />
für fäkale Verunreinigungen im <strong>Wasser</strong>. Aufgrund<br />
seines natürlichen Habitats ist er wenig resistent gegen<br />
Umwelteinflüsse und Chemikalien. Zum Überleben in<br />
Sedimenten und vor allem zur Vermehrung ist E. coli auf<br />
eine gute Versorgung mit Nährstoffen angewiesen [2].<br />
Der Nachweis von Escherichia coli erfolgte im Labor<br />
Dr. Schell, Augsburg, mit dem Colilert®-2000-System.<br />
Zu Beginn der zweiten Beprobungsserie wurde eine<br />
Parallel-Probe im Institut für Hygiene und Öffentliche<br />
Gesundheit in Bonn mittels Merck CC-Agar ® untersucht.<br />
3.2 MS2-Coliphagen<br />
(Bakterio)-Phagen sind Viren, die Bakterien befallen.<br />
Unter Coliphagen versteht man Phagen, die auf Bakterien<br />
der Art E. coli spezialisiert sind. Die als MS2-Coliphagen<br />
bezeichneten Phagen gehören taxonomisch zur<br />
Gattung Levivirus. Es handelt <strong>sich</strong> dabei um ikosaedrische,<br />
rund 30 Nanometer große RNA-Phagen, die in der<br />
Lage sind, bestimmte Wirtsstämme mit so genanntem<br />
F-Pile zu infizieren und in geschlossenen Bakterienrasen<br />
unter entsprechenden Kulturbedingungen <strong>sich</strong>tbare<br />
Plaques (klare Zonen) zu produzieren.<br />
Coliphagen gelten in Rohwasser als Indikatoren für<br />
Viren aus fäkalen Kontaminationen und als Anzeiger für<br />
unzureichende Filterkapazitäten gegenüber viralen<br />
Krankheitserregern. Sie sind nicht humanpathogen,<br />
wodurch sie <strong>sich</strong> als Modellorganismen für den Transport<br />
von Viren, aber auch von anderen kolloidalen Kontaminationen<br />
(Bales, Gerba et al. 1989) besonders anbieten.<br />
Der Nachweis der MS2-Coliphagen erfolgte im Institut<br />
für Hygiene und Öffentliche Gesundheit nach den<br />
Vorgaben der DIN EN 10705-2 von 2001.<br />
3.3 Bacillus subtilis–Sporen<br />
Das Bacillus subtilis, auch Heubazillus genannt, ist ein<br />
fakultativ anaerobes, peritrich begeißeltes Bodenbakterium.<br />
Die Größe der stäbchenförmigen Bakterien<br />
beträgt va. 0,6 · 2 µm.<br />
Obwohl ubiquitär verbreitet, ist er am häufigsten zu<br />
isolieren aus den oberen Schichten des Bodens. Dort ist<br />
er aufgrund häufig wechselnder Umgebungsbedingungen<br />
fast ständig Stress- und Hungersituationen ausgesetzt,<br />
die er durch die Bildung von Endosporen überdauern<br />
kann. Aufgrund der hohen Hitzeresistenz der<br />
Sporen werden diese auch als Indikator bei entsprechenden<br />
Sterilisationsprozessen in Pharmazie, Medizin<br />
und Lebensmittelindustrie eingesetzt. B. subtilis ist im<br />
Gegensatz zu anderen Bacillaceae (z. B. B. anthracis oder<br />
B. cereus) nicht humanpathogen, was ihn zu einem<br />
idealen Testkeim für Laborarbeiten macht.<br />
4. Versuchsablauf<br />
Um den Systemen etwas Zeit zu geben, <strong>sich</strong> einzuregeln,<br />
wurden beide Säulen rund drei Wochen lang mit<br />
<strong>Wasser</strong> aus dem <strong>Wasser</strong>werk durchspült. Zu Beginn der<br />
eigentlichen Dotierungsversuche wurden jeweils<br />
500 mL von Suspensionen der drei Testorganismen als<br />
Stoßbelastung auf jede Säule gegeben. Die Konzentrationen<br />
der eingesetzten Organismen betrugen jeweils<br />
etwa 10 10 Organismen/100 mL.<br />
Jeweils ab zwei Tage nach Dotierung wurden nacheinander<br />
an allen Entnahmehähnen beider Säulen alle<br />
24 Stunden Proben entnommen. Der ursprüngliche<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1063