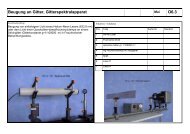Strom aus Licht - Institut für naturwissenschaftliche Grundlagen
Strom aus Licht - Institut für naturwissenschaftliche Grundlagen
Strom aus Licht - Institut für naturwissenschaftliche Grundlagen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 3: Physik der Halbleiter 24<br />
Dotiert man einen Halbleiter mit dreiwertigen Atomen, baut man beispielsweise Boratome ein,<br />
so fehlt ein Valenzelektron, um dieses mit seinen vier nächsten Nachbarn kovalent zu binden<br />
(Fig. 3.4). Es besteht eine Bindungslücke, kurz: ein Loch.<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Akzeptor<br />
B<br />
+5<br />
-2<br />
negativ<br />
schwache Bindung<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
Loch<br />
positiv<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Si<br />
+14<br />
-10<br />
neutral<br />
Fig. 3.4 Boratom als Akzeptor im Siliziumkristall. Die grauen Ringe um die weiss dargestellten<br />
Atomkerne repräsentieren die Elektronenhüllen der Atomrümpfe. Die eingetragenen Zahlen<br />
geben die Ladung an. Mit "neutral, positiv, negativ" wird angegeben, wie das zum jeweiligen<br />
Atom gehörende Gebiet ("Atomgebiet") per Saldo geladen ist. Insgesamt ist der p-Halbleiter<br />
elektrisch neutral, da die negativen Akzeptoren und die positiv geladenen "Atomgebiete" der<br />
Löcher sich die Waage halten.<br />
Wird dieses Loch von einem "Nachbarelektron" aufgefüllt, so hinterlässt dieses "Nachbarelektron"<br />
an seinem Ursprungsort ein neues Loch. Auch Löcher sind beweglich! Durch eine<br />
derartige Abwanderung eines Lochs wird das Ladungsgleichgewicht in der Umgebung des Boratoms<br />
gestört. Das "Boratomgebiet" enthält ein Elektron zuviel und bildet eine "negativ geladene<br />
Stelle" im Kristall. Das Loch bleibt ähnlich wie das "überflüssige" Valenzelektron beim Arsenatom<br />
schwach an diese negativ geladene Stelle gebunden, kann sich aber auch relativ leicht von<br />
dieser Stelle entfernen, um dann später irgenwann von einem anderen Loch wieder ersetzt zu<br />
werden. Löcherwanderung in eine Richtung bedeutet aber nichts anderes als Elektronenwanderung<br />
in entgegengesetzter Richtung. Da mit der Bewegung eines Lochs die Bewegung eines per<br />
Saldo einfach positiv geladenen "Atomgebiets" verbunden ist, entspricht der Wanderung eines<br />
Lochs die Wanderung einer positiven Ladung. Man spricht von Löcherleitung.<br />
Veranschaulichung: Die Löcherwanderung ist analog zur "Wanderung" eines freien Platzes<br />
in einer Sitzreihe im Kino: Das Aufrücken der Kinobesucher (Elektronen) beispielsweise nach<br />
links führt dazu, dass der freie Platz (Loch) nach rechts wandert. Allerdings gibt es im Halbleiter<br />
gleichzeitig Löcher und freie Elektronen nebeneinander.<br />
Der Einbau dreiwertiger Fremdatome erzeugt also im Halbleiter die oben beschriebenen<br />
Löcher. Da sie zumindest vorübergehend ein Elektron "importieren" und "beherbergen", nennt<br />
man die eingebauten dreiwertigen Fremdatome Akzeptoren (Empfänger). Die Beweglichkeit der<br />
ETH-Leitprogramm Physik<br />
<strong>Strom</strong> <strong>aus</strong> <strong>Licht</strong>