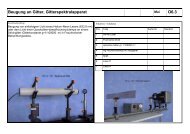Strom aus Licht - Institut für naturwissenschaftliche Grundlagen
Strom aus Licht - Institut für naturwissenschaftliche Grundlagen
Strom aus Licht - Institut für naturwissenschaftliche Grundlagen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 4: Solarzellen 38<br />
4.3 Solargeneratoren<br />
Wie schon erwähnt, müssen viele Solarzellen zusammengeschaltet werden, bis eine elektrische<br />
Leistung resultiert, die mehr kann, als bloss einen Taschenrechner anzutreiben. (Das heisst<br />
nicht, Solarrechner seien unsinnig: Die Entsorgung der Batterien und Akkumulatoren gewöhnlicher<br />
Rechner ist leider noch ein düsteres Kapitel!) Betrachten wir einen modernen, käuflichen<br />
Solargenerator oder ein Solar-Panel, wie manche lieber sagen:<br />
Daten <strong>für</strong> einen Solargenerator<br />
• 36 monokristalline, weitgehend quadratische Silizium-Solarzellen sind in 3 Reihen à 12<br />
Zellen witterungsbeständig zwischen zwei Plexiglasscheiben eingegossen.<br />
• Sie sind alle in Serie geschaltet, so dass die Betriebsspannung bis 20 V beträgt.<br />
• Bei maximalem Sonnenlicht vermögen sie über 3 A <strong>Strom</strong> abzugeben.<br />
• Wenn die Temperatur nicht zu hoch ist, leistet der Solargenerator 55 W.<br />
• Der Wirkungsgrad erreicht nun Werte von gegen 15 %.<br />
• Der Preis <strong>für</strong> einen einzelnen Generator beträgt rund 700.- Schweizerfranken.<br />
• Der Generator misst etwa 130 cm x 35 cm, ist 4 mm dick und bedingt windbeständig.<br />
Hot-Spots und andere Probleme<br />
Nichts Reales ist vollkommen, auch Solarzellen nicht! Es kann sein, dass sich unter 36<br />
Solarzellen eine minderwertige oder sogar defekte befindet. Das ist trotz Qualitätskontrolle nicht<br />
<strong>aus</strong>zuschliessen, denn bis heute stellt die Photodegradation ein Problem dar: Zellen, die einwandfrei<br />
scheinen, verlieren unter dem Einfluss der ersten Belichtung bis zu 10 % der Soll-<br />
Leistung, vermutlich weil sich Atome in der Verarmungszone verschieben.<br />
Viel wahrscheinlicher ist aber, dass perfekte Zellen durch Blätter, Vogeldreck oder andere<br />
Imponderabilien abgedunkelt werden. Dass solche Zellen keine Elektrizität erzeugen, ginge<br />
noch. Sie werden aber vom <strong>Strom</strong> der übrigen Zellen durchflossen, bilden einen hochohmigen<br />
Verbraucher und erhitzen sich merklich: sie bilden einen Hot-Spot. In Figur 4.4 ist dargestellt,<br />
wie dieses Problem durch Parallelschalten einer gewöhnlichen Diode behoben werden kann.<br />
+<br />
usw.<br />
-<br />
usw.<br />
Figur 4.4: Parallel-Diode (Bypassdiode) gegen Hot-Spots.<br />
Während der <strong>Strom</strong> der Solarzellen "usw." durch die Bypassdiode fliessen könnte, wenn die<br />
perfekte Zelle beschattet wäre, sperrt die Diode im Normalfall. - Ein analoges Problem entsteht<br />
beim Parallelschalten mehrerer Zellen, die nicht genau gleich hohe Spannungen liefern: Dort<br />
muss eine Seriediode unerwünschte Ströme sperren. Ein weiteres Problem bei Solaranlagen<br />
bildet der Blitzschutz der Generatoren, die im Freien aufgestellt werden.<br />
ETH-Leitprogramm Physik<br />
<strong>Strom</strong> <strong>aus</strong> <strong>Licht</strong>