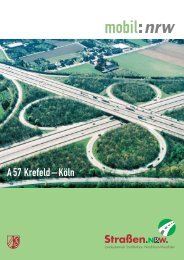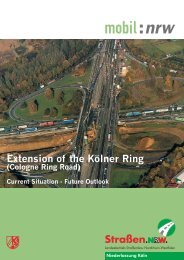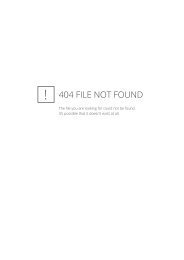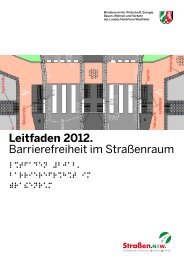RLBP 2011 - StraÃen.NRW
RLBP 2011 - StraÃen.NRW
RLBP 2011 - StraÃen.NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege im Straßenbau – Teil A – Abschnitt 2<br />
Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (<strong>RLBP</strong>)<br />
• UVS zur Linienfindung<br />
• Daten der örtlichen und überörtlichen Landschaftsplanung: Landschaftsprogramme,<br />
Landschaftsrahmen-, Landschafts- und Grünordnungspläne<br />
• Daten der Naturschutzbehörden: Arten- und Biotopschutzprogramme, Schutzgebietsverordnungen,<br />
Pflege- und Entwicklungspläne, Managementpläne, landesweite Biotopkartierungen<br />
etc.<br />
• Daten der Gesamtplanung: Landes- und Regionalpläne, Flächennutzungspläne<br />
• sonstige Fachpläne: Forstliche Rahmenpläne, Agrarstrukturelle Planungen.<br />
und einer Begehung des Projektgebietes durchgeführt.<br />
Die vom Straßenbauvorhaben ausgehenden Wirkungen sind mit Hilfe der zur Verfügung stehenden<br />
straßenbaulichen bzw. verkehrlichen Daten zu ermitteln. In Abhängigkeit vom<br />
Vorhabentyp können einzelne Wirkungen, wie Schadstoff- oder Lärmemissionen, von vornherein<br />
ausgeschlossen werden (z. B. bei einem Anbau eines Radweges).<br />
Relevant sind solche Wirkungen, bei denen in einem bestimmten Wirkraum (= Raum, in dem<br />
Störungen und Schädigungen auftreten können) von Veränderungen der Ist-Situation auszugehen<br />
ist.<br />
Des Weiteren sind im betroffenen Landschaftsraum die Funktionen und Strukturen auszumachen,<br />
die wegen ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit und einer sich daraus ableitenden<br />
Schutzwürdigkeit von maßgeblicher Bedeutung für den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild<br />
sind (siehe zur Auswahl planungsrelevanter Funktionen auch MB 1).<br />
Aufgrund des Wirkungsgefüges können Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes /<br />
des Landschaftsbildes voneinander abhängen und sich gegenseitig voraussetzen. Somit<br />
muss auch nicht jeder Bestandteil im Einzelnen erfasst sein, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit<br />
des Systems abzubilden. Bestimmte, als planungsrelevant identifizierte Funktionen<br />
indizieren somit andere und stehen stellvertretend für diese (Indikationsprinzip).<br />
Beispiel: In einer Aue bestimmt das Überschwemmungsregime als entscheidendes Merkmal aller<br />
Prozesse am Fluss (Erosion, Sedimentation, Überflutung) die Verteilung von überschwemmungsbestimmten<br />
Artenvorkommen (z. B. Flussregenpfeifer) und Lebensräumen bzw. Biotopstrukturen (z. B.<br />
Weichholzaue, Nass-Grünland und Eichen-Hainbuchenwald). Die Biotopstrukturen bilden insbesondere<br />
bei deren naturnaher Ausprägung den Boden-Wasserhaushalt und die Bodenverteilung ab und<br />
prägen das Landschaftsbild. Eingriffe in Biotopstrukturen der Aue implizieren die Beeinträchtigungen<br />
von Aueböden sowie von Grundwasserverhältnissen. Funktional gleichartige Maßnahmen zur Renaturierung<br />
von verbauten, intensiv genutzten Auenabschnitten zu naturnahen Gewässerabschnitten mit<br />
Auevegetation sind gleichzeitig geeignet, diese nicht gesondert erfassten Funktionen mit zu kompensieren.<br />
Dabei ist gleichzeitig die Frage der Planungsrelevanz zu beantworten, ob also diese prägenden<br />
Funktionen und Strukturen überhaupt von den Wirkungen des Straßenbauvorhabens<br />
betroffen werden.<br />
In der weiteren Betrachtung sind daher Funktionen und Strukturen auszuschließen, die<br />
• von den Wirkungen des Vorhabens nicht erreicht werden,<br />
Kap. 4 Methodik und Ablauf der landschaftspfleg. Begleitplanung mit artenschutzrechtlicher Prüfung 17