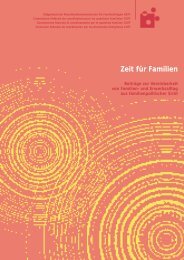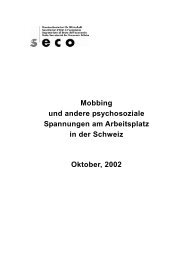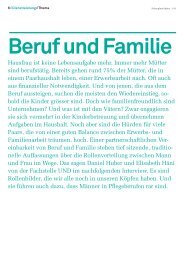Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und ...
Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und ...
Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vielfältig wie die privaten Situationen sind auch die beruflichen Realitäten an den <strong>Hochschulen</strong>,<br />
die Frage der Vereinbarkeit von Beruf <strong>und</strong> Privatleben betrifft die Angehörigen<br />
der <strong>Hochschulen</strong> in allen Funktionen: das akademische wie das administrative Personal,<br />
den Mittelbau, Sekretariatsmitarbeitende, Personen in Dienstleistungs- <strong>und</strong> Managementfunktionen,<br />
Professorinnen <strong>und</strong> Professoren wie auch die Studierenden.<br />
Stehen im Arbeitsprozess meist die Stationen der beruflichen Biografie im Zentrum, so<br />
beschäftigt sich die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf <strong>und</strong> Familie mit der Schnittstelle<br />
von Beruf <strong>und</strong> Privatleben, dem Ineinandergreifen von beruflicher <strong>und</strong> privater<br />
bzw. sozialer Biografie. Diese sich heute stark verändernden Lebensbiografien stehen in<br />
einem historisch gewachsenen politischen <strong>und</strong> institutionellen Rahmen, der sich den<br />
jeweiligen Bedürfnissen mehr oder weniger schnell anpasst. Dies impliziert neue Positionierungen,<br />
wie sie derzeit im Kontext der Demografiedebatte, der Arbeitsteilung zwischen<br />
den Geschlechtern, der Organisation von Kinderbetreuung, des Pensionierungsalters<br />
ausgehandelt werden. Dabei werden das Verhältnis von Privatleben <strong>und</strong> Beruf <strong>und</strong><br />
die Trennlinie dazwischen unterschiedlich gedeutet <strong>und</strong> konstruiert.<br />
Beide Bereiche, Beruf <strong>und</strong> Familie, sind Orte der Herausforderung, der Sinnstiftung, der<br />
Leistung, beide Bereiche können als potenzielle Rückzugsgebiete gesehen werden. Die<br />
Familie als erholsamer, intimer, persönlicher Raum <strong>und</strong> Gegenpol zu Druck, Belastung<br />
oder Routine im Beruf. Genauso gut kann das Büro dank weitgehender Professionalisierung<br />
der Arbeitsteilung <strong>und</strong> formalisierter <strong>und</strong> damit teilweise zivilerer Kommunikationsformen<br />
zum Zufluchtsort vor ausufernden familiären Ansprüchen werden (Hochschild,<br />
2006).<br />
Umkämpftes Gut in der konkurrenzierenden Beziehung von Privatleben <strong>und</strong> Beruf ist<br />
die Zeit. Dabei geht es nicht nur darum, genügend Zeit für die Familie, genügend Zeit für<br />
den Beruf, sondern auch Zeit für sich selbst zu haben. Der neue Begriff des «Zeitwohlstands»<br />
(Heitkötter/Schneider, 2004) markiert diese Bedingung geglückten Zeitbesitzes<br />
<strong>und</strong> damit die Realisierung dessen, was heute mit Work-Life-Balance angestrebt<br />
wird. Vereinbarkeit ist eine Frage von Strukturen, die organisiert werden können, sie ist<br />
gleichzeitig immer auch die Frage der Energie des «inneren Haushalts» in der Erfüllung<br />
der Rollen, die in diesem Fall Erwerbstätige <strong>und</strong> Studierende in ihrem Erwachsenenleben<br />
wahrnehmen.<br />
Gesellschaftliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Gründe<br />
Mehr <strong>und</strong> mehr werden die von der Gesellschaft als wertvoll betrachteten sozialen Aufgaben<br />
nicht mehr als reine Privatsache Einzelner verstanden, sondern als Aufgabe in<br />
einem gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Kontext. Dies wird im Zug gegenwärtiger<br />
Debatten um mögliche Lösungen der öffentlichen Kinderbetreuung <strong>und</strong> Betagtenpflege<br />
deutlich (Eckart, 2000).<br />
Als gängigstes Argument für die Förderung der Vereinbarkeit wird der Wandel familiärer<br />
Strukturen angeführt, beziffert mit der steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen. Die<br />
Erwerbsquote der Frauen in der Schweiz schwankte 2007 zwischen 80% <strong>und</strong> 85%. 72%<br />
der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sind erwerbstätig, 57% in Teilzeit <strong>und</strong> nur 15%<br />
in Vollzeit beschäftigt. 90% der Männer mit Kindern unter 15 Jahren sind vollzeitlich<br />
erwerbstätig. 2<br />
Ein weiterer Gr<strong>und</strong> für Handlungsbedarf ist die in der Öffentlichkeit debattierte zunehmende<br />
Alterung der Gesellschaft. Einfluss darauf haben die erhöhte Lebenserwartung,<br />
2<br />
Erwerbsquote (EQ) bedeutet den Prozentsatz der Erwerbstätigen aus der erwerbsfähigen Altersgruppe. Die EQ sagt nichts über die<br />
Höhe der Arbeitspensen aus. Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE).<br />
<strong>Familienfre<strong>und</strong>liche</strong> <strong>Hochschulen</strong>: <strong>Handlungsfelder</strong> <strong>und</strong> Praxisbeispiele 12/128<br />
Carmen Lack, Nathalie Amstutz, Ursula Meyerhofer