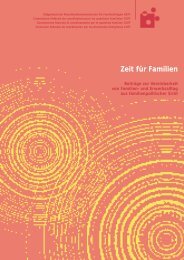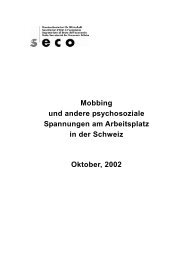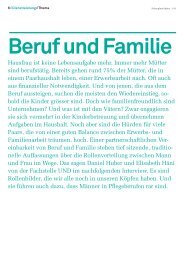Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und ...
Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und ...
Familienfreundliche Hochschulen: Handlungsfelder und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Es gibt ferner eine «vertragliche» Segregation: Frauen sind tendenziell mit kleineren<br />
Pensen <strong>und</strong> statustiefer als Männer angestellt. Insbesondere auf allen Stufen des akademischen<br />
Qualifikationsprozesses haben Frauen im Schnitt statusniedrigere – beginnend<br />
mit einer durchschnittlich niedrigeren Eintrittsposition – <strong>und</strong> kürzer befristete<br />
Positionen inne, verb<strong>und</strong>en mit einem höheren Austrittsrisiko (Bald et al., 2003; BBT u.<br />
BFS, 2007; Lind, 2004; Ulmi/Maurer, 2005).<br />
Hochschulmitarbeitende mit Kindern<br />
Eine deutsche Studie aus dem universitären Bereich (Flaake, 2008) besagt, dass Kinder<br />
zu haben <strong>und</strong> gleichzeitig an der akademischen Karriere zu bauen, für Frauen Unterfangen<br />
sind, die sich nahezu ausschliessen oder aber einen extrem schwierigen biografischen<br />
Weg bedeuten.<br />
Die Dokumentation «Geschlechterdifferenz <strong>und</strong> Nachwuchsförderung in der Wissenschaft»<br />
(Ulmi/Maurer, 2005) zeichnet folgendes Bild:<br />
- Bei Akademikerinnen besteht im Vergleich mit anderen Frauen eine überdurchschnittliche<br />
Kinderlosigkeit; eine verzögerte Familiengründung <strong>und</strong> durchschnittlich<br />
weniger Kinder sind zu beobachten.<br />
- Je höher die Qualifikation, desto niedriger ist die Geburtenrate <strong>und</strong> umso höher die<br />
Kinderlosigkeit.<br />
- Professorinnen der jüngeren Generation sind im Vergleich mit ihren älteren Kolleginnen<br />
häufiger Mütter. Wie eine jüngere Untersuchung des Max-Planck-Instituts<br />
zeigt, unterbrechen Frauen nicht mehr «automatisch» ihre wissenschaftliche Tätigkeit<br />
oder brechen diese ab, wenn sie Kinder geboren haben, da sie auf Unterstützung<br />
bei der Kinderbetreuung – extern oder privat – zurückgreifen können.<br />
- Frauen kombinieren wissenschaftliches Arbeiten im Vergleich mit ihren Kollegen<br />
immer noch wesentlich seltener mit der Gründung einer Familie. Es bleibt für Frauen<br />
problematischer, Kinder zu haben <strong>und</strong> wissenschaftliche Karriere zu machen, als<br />
für Männer. Im Gegensatz zu in der Wissenschaft tätigen Müttern sind bzw. fühlen<br />
sich Väter durch die Familie weniger bis gar nicht belastet.<br />
Vorurteile gegenüber der Vereinbarkeit von wissenschaftlichem Arbeiten<br />
<strong>und</strong> Familie<br />
Eine weitere Untersuchung (Lind, 2004) über die Karrierewege von Wissenschaftlerinnen<br />
zeigt eine zusätzliche Perspektive auf. Es existieren weitverbreitete <strong>und</strong> sehr deutliche<br />
Vorurteile gegenüber der Vereinbarkeit von Beruf <strong>und</strong> Familie, die als ein Haupthindernis<br />
für den beruflichen Aufstieg von Wissenschaftlerinnen genannt werden. Entgegen<br />
diesen Vorstellungen hat sich Mutterschaft faktisch bei entsprechender Unterstützung<br />
nicht als ein zentrales Hemmnis für eine wissenschaftliche Karriere erwiesen.<br />
Vielmehr scheint aber eben diese Vorstellung von Unvereinbarkeit in einer negativen<br />
Leistungserwartung gegenüber Wissenschaftlerinnen zu resultieren. Dies trifft auch<br />
Frauen ohne Kinder, da diese ebenfalls als potenzielle, d.h. zukünftige Mütter betrachtet<br />
werden. Die Untersuchung weist nach, dass im Wissenschaftsbereich oft eine Arbeitskultur<br />
vorherrscht, die mit einer hohen Verfügbarkeitserwartung einhergeht; auf Frauen –<br />
aber auch Männer –, die diesen Erwartungen zeitlichen Dauerengagements nicht nachzukommen<br />
scheinen, wirkt sich dies ausgrenzend aus. In der Folge müssen Wissenschaftlerinnen<br />
negative Leistungszuschreibungen durch erhöhten Zeiteinsatz kompensieren,<br />
entsprechend benachteiligt sind sie dann mit weiteren Familienpflichten (vgl.<br />
auch Osterloh/Wübker, 1999).<br />
<strong>Familienfre<strong>und</strong>liche</strong> <strong>Hochschulen</strong>: <strong>Handlungsfelder</strong> <strong>und</strong> Praxisbeispiele 24/128<br />
Carmen Lack, Nathalie Amstutz, Ursula Meyerhofer