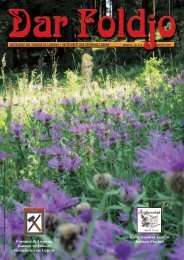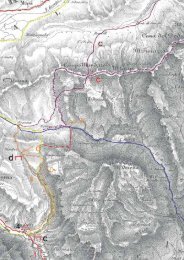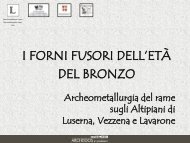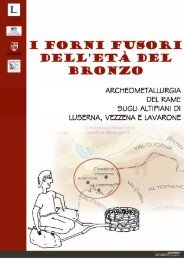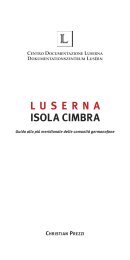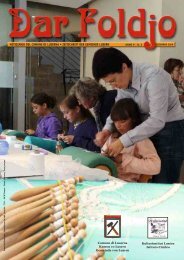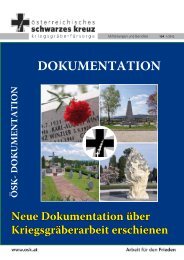154durch Metallrohre in den Ofen geleitet wird, wo er <strong>di</strong>e verschiedenen Abteilungendurchlaufen muss und sich überall ausdehnt, bevor er abziehenkann. Wo man viel kocht oder dort wo man das Futter für <strong>di</strong>e Tiere zubereitet,genügt eine solche Beheizung, andernfalls können Öfen <strong>di</strong>eser Art wienormale Öfen beheizt werden. Selten findet man Holzbänke um <strong>di</strong>e Öfen. In<strong>Lusern</strong> gibt es keine holzgetäfelten Stuben“.<strong>Der</strong> Ausdruck „Stube“, oder der mit einem Ofen geheizte Raum, stammtetymologisch aus dem Altdeutschen, dessen Wurzel <strong>di</strong>eselbe des friesischenAusdrucks Stoev oder Stoevchen ist, mit welchem kleine Wärmetöpfe ausMessing oder aus Tonerde bezeichnet wurden, <strong>di</strong>e auch in <strong>Lusern</strong> verbreitetwaren. <strong>Der</strong> Ursprung <strong>di</strong>eser Gegenstände geht auf <strong>di</strong>e Römerzeit zurück, alsman zum erwärmen der Häuser tragbare, geschlossene Behälter benützte inwelchen man Holz verbrannte, ein Mittel<strong>di</strong>ng zwischen dem Bettwärmer unddem Metallofen.Auch <strong>di</strong>e mit Glut gefüllten Bettwärmer aus Kupfer oder Eisen leitetensich aus den Heizsystemen des alten Roms ab: waren sie ohne Deckel, sostellte man sie in eine Holzstruktur, <strong>di</strong>e sogenannte „monega“.<strong>Der</strong> chronikhalber erinnern wir an andere Begriffe deutschen Ursprungs:das lateinische Wort „cacabus“ (ein in den Ofen eingelassener Topf ), abgeleitetaus dem Altdeutschen „Kachel“ und „olle“, ein Wort langobar<strong>di</strong>schenUrsprungs, deutet auf Gefäße aus Tonerde hin, heute noch im TrentinerSprachgebrauch üblich, mit der abgeänderten Bedeutung für das Wort Kacheln.Von der deutschen Stube stammt auch – in der mundartlichen Ableitungder Alpentäler – das la<strong>di</strong>nische Wort „stuva“ oder „stiva“.<strong>Das</strong> hauptsächlich in den Regionen des Alpenraumes und in Mitteleuropagängige Modell war das eines Ofens, der aus Mauerwerk oder aus Stein gebautwurde; im wesentlichen handelte es sich um eine massive Struktur ausSteinplatten oder aus Hohlplatten aus Schamottematerial, <strong>di</strong>e einen speziellenBrennraum bilden. Die nachfolgenden Heizgaszüge werden zur Speicherungder Wärme ebenfalls aus Schamottematerial gemauert und bilden den Weg fürden warmen Rauch (den sogenannten „Rauchring“); <strong>di</strong>e Wärme wird absorbiert,gespeichert um dann langsam an <strong>di</strong>e Außenverkleidung abgegeben (beiden Steinöfen an weitere Platten, in <strong>di</strong>e manchmal Muster eingeritzt wurdenund beim gemauerten Ofen waren es wieder mit Kalk verspachtelten, eventuellbemalten Ziegelelemente) <strong>di</strong>e dann <strong>di</strong>e Wärme in den Raum ausstrahlten.Rund um den Ofen baute man häufig ein Gerüst aus Holz das <strong>di</strong>e Errichtungeiner Sitzbank ermöglichte, es <strong>di</strong>ente aber auch zum Aufhängen <strong>von</strong>Wäsche, <strong>di</strong>e getrocknet werden musste; das wichtigste aber war, dass auf <strong>di</strong>e-
155per la capacità <strong>di</strong> accumulare calore e <strong>di</strong> cederlo uniformemente all’ambiente.È particolarmente conveniente se si ha la possibilità <strong>di</strong> stivare la legnanecessaria al suo funzionamento e va considerata per le sue caratteristiche,che la fanno collocare tra i migliori sistemi <strong>di</strong> riscaldamento dal punto <strong>di</strong>vista della salubrità, dato che riscalda in massima parte secondo i principidell’irraggiamento, assicurando una piacevole sensazione <strong>di</strong> calore con temperaturabassa dell’aria e più elevata delle pareti che circondano il locale nelquale la stufa è posizionata. Collocata preferibilmente al centro dell’e<strong>di</strong>fìcio,tra<strong>di</strong>zionalmente a cavallo tra il locale cucina e la zona <strong>di</strong> soggiorno-letto,comunque sempre in una posizione strategica rispetto alla possibilità <strong>di</strong> irra<strong>di</strong>arecalore “dal centro alla periferia”, può essere considerata, lì dove ilsuo uso si è mantenuto, il vero e proprio cuore della casa. Esistono essenzialmentedue tipi <strong>di</strong> “Kachelofen” – lo si è accennato nelle pagine precedenti – emoltissime varianti per quanto riguarda la forma. I due tipi sono: la stufaintonacata a calce e la stufa rivestita <strong>di</strong> piastrelle <strong>di</strong> maiolica (le olle). Perquanto riguarda le forme, su una certa co<strong>di</strong>ficazione tra<strong>di</strong>zionale, che prevedealcune realizzazioni standar<strong>di</strong>zzate, già all’inizio del Novecento si sonosviluppate versioni più fantasiose e creative.Ripetiamo che <strong>di</strong> solito attorno alla “Kachelofen” corre una panca <strong>di</strong> legnoe sopra a essa, a volte, è prevista una struttura, anch’essa <strong>di</strong> legno, chepuò essere utilizzata come giaciglio. La “Kachelofen” va costruita sul luogoutilizzando pietra o materiale refrattario e prevedendo la sapiente messa inopera <strong>di</strong> “giri <strong>di</strong> fumo”: questi costringono il calore a dei percorsi nei qualiesso viene ceduto al materiale, che ha il compito <strong>di</strong> accumularlo, per poi cederlolentamente per irraggiamento delle sue superfìci calde e per riverberodelle pareti della stanza. La costruzione oggi per lo più avviene a opera <strong>di</strong>maestri fumisti, ma tra<strong>di</strong>zionalmente ogni capofamiglia costruiva da sé lapropria stufa rinnovando un sapere trasmesso <strong>di</strong> generazione in generazione:talvolta succede ancora oggi, per esempio nelle valli del Sudtirolo.L’irraggiamento prodotto dalla stufa non produce sensibili movimentid’aria, riducendo al minimo la circolazione della polvere con tutti i suoi effettidannosi. Inoltre il risparmio energetico che consente è notevole: la suacapacità <strong>di</strong> accumulare calore e <strong>di</strong> cederlo lentamente quando sia a regime,consente <strong>di</strong> caricare con legna la stufa solo due volte al giorno, al mattino ealla sera. La sua resa ottimale <strong>di</strong>pende in gran parte dalla continuità <strong>di</strong> caricae dalla capacità <strong>di</strong> capire <strong>di</strong> quanta e <strong>di</strong> quale legna essa abbia bisogno perdare il meglio <strong>di</strong> sé. Ogni “Kachelofen” è un po’ come un forno che una bravacuoca deve imparare a conoscere perché possa essere utilizzato nel modopiù sod<strong>di</strong>sfacente. In ogni caso, qualora sia adeguatamente progettata per
- Seite 5 und 6:
5IntroduzioneCon questo libretto il
- Seite 9 und 10:
9VorbortPit dizza libarle, dar Kult
- Seite 11:
Località Hoff distrutta dall’inc
- Seite 18:
18Mappa catastale della parte super
- Seite 22 und 23:
22zu suchen, damals im Besitze des
- Seite 24 und 25:
24Immagine storica, con la chiesa i
- Seite 27 und 28:
2CapitoloKapitel
- Seite 29 und 30:
29Caratteristicheurbanistico-archit
- Seite 32 und 33:
32Die Wohnung ist meistens in zwei
- Seite 35:
Cartolina di Luserna/Lusérn spedit
- Seite 40 und 41:
40Luserna/Lusérn: in primo piano l
- Seite 42:
421905, la piazza di Luserna/Lusér
- Seite 45:
45A queste attività si affianca l
- Seite 48:
48Nuova via di accesso al paese, l
- Seite 51 und 52:
51Apprendiamo inoltre che Luserna/L
- Seite 53:
53«In compagnia di quest’ultimo
- Seite 56:
56Asilo infantile tedesco • Deuts
- Seite 59 und 60:
59Scolaresca di Luserna/Lusérn •
- Seite 61 und 62:
61tutto a spese della Lega, si è a
- Seite 63 und 64:
63posta a metà della facciata, una
- Seite 66 und 67:
66scher zählt und dass die Ortscha
- Seite 69 und 70:
69si temerebbe anche qui qualche co
- Seite 72:
72PFARRAMTVON CAPPELLA (LAVARONE)An
- Seite 77 und 78:
4CapitoloKapitel
- Seite 79 und 80:
79L’incendioL’eventoL’incendi
- Seite 81 und 82:
81questo piano con quello superiore
- Seite 84 und 85:
84Case del centro storico devastate
- Seite 86 und 87:
86Zu jener Zeit sind laut der bisch
- Seite 89 und 90:
89Si riportano di seguito alcuni de
- Seite 91 und 92:
Il Popolo, 11 agosto 1911 / 11. Aug
- Seite 93 und 94:
L’Alto Adige, 23-24 agosto 1911 /
- Seite 95 und 96:
95Il Comitato di SoccorsoAppena dom
- Seite 97 und 98:
97I nazionalismi che da decenni si
- Seite 99 und 100:
99ne; a Levico, al cinematografo Io
- Seite 101 und 102:
101Chiediamo cortesemente di inviar
- Seite 103 und 104: 103Alcune richieste di aiutoSi ripo
- Seite 105: 105Richiesta d’aiuto !Il 9 agosto
- Seite 108 und 109: 108Consiglio Provinciale d’Agrico
- Seite 110 und 111: 110sich die Sektion erlaubt zu unte
- Seite 112 und 113: 112Futter und zwar, Heu, Stroh, Gri
- Seite 114 und 115: 114Lettera dell’insegnante italia
- Seite 116 und 117: 116
- Seite 118 und 119: 118Lega nazionale6. 10. 9111408Ehre
- Seite 120 und 121: 120Der WiederaufbauDie Wiederaufbau
- Seite 122 und 123: 122aufbau des Dorfes sind auch die
- Seite 124 und 125: 124Ankauf von Bauholz sondern auch
- Seite 126 und 127: 126Sitzungsprotokollder Gemeindever
- Seite 128 und 129: 128D. Nikolussi Castellan eigenhän
- Seite 130 und 131: 130Aus dem Inventar der Gemeinde Lu
- Seite 133 und 134: 5CapitoloKapitel
- Seite 135 und 136: 135Storie del focolareIl fuoco nell
- Seite 137 und 138: 13730 maggio 1792 - che niuno ardis
- Seite 139 und 140: 139per ogni casa vi fosse almeno un
- Seite 141 und 142: 141“Regolamento per evitare gl’
- Seite 143 und 144: 14319. Nissuno potrà tenere più d
- Seite 145 und 146: 145go, ed invigilino per iscoprire,
- Seite 147 und 148: 147con ferri ed altri attrezzi util
- Seite 149 und 150: 149ne delle trattorie, dove si stav
- Seite 151 und 152: 151Gli edifici recenti avevano pian
- Seite 153: 153to riscaldamento, altrimenti stu
- Seite 157 und 158: 157l’ambiente che si desidera ris
- Seite 159 und 160: 159L’iniziale lentezza del rilasc
- Seite 161 und 162: 161blandi per le paste e i dolci, i
- Seite 163 und 164: Via Trento/Stradù, inizi 1900 •