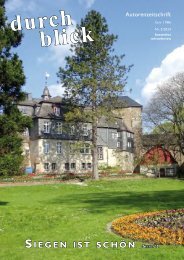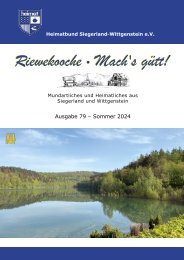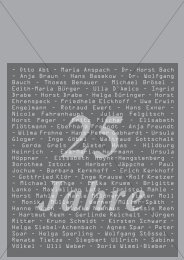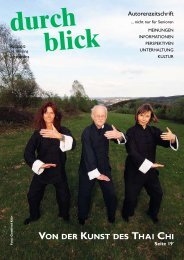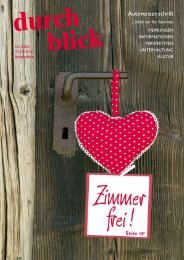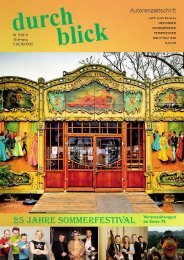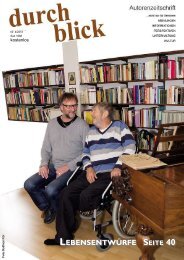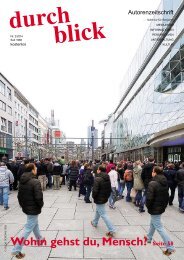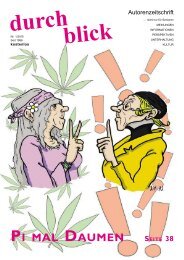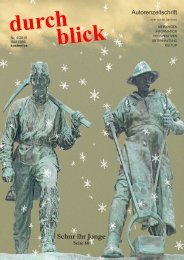2014-04
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
in diesem Beitrag beschäftige ich mich (nur!) mit der rein<br />
philosophisch-theologisch ausgerichteten ethischen Frage<br />
nach einem selbstbestimmten Sterben und Tod. Haben wir<br />
Menschen das Recht und die Freiheit, das Ende unseres persönlichen<br />
Lebens selbst zu bestimmen, oder gibt es so etwas<br />
wie eine Pflicht zu leben, sowohl Gott als auch der Gesellschaft<br />
gegenüber? Diese kontroversen Positionen ziehen sich<br />
wie ein roter Faden bis heute (nicht nur) durch die abendländische<br />
Geistesgeschichte. Ganz aktuell (Herbst <strong>2014</strong>) finden<br />
sie bei uns in Deutschland ihrenAusdruck in der anhaltenden<br />
Bundestagsdebatte über eine Neuregelung des Gesetzes zur<br />
Sterbehilfe, in der der sonst übliche Fraktionszwang aufgehoben<br />
ist, sodass jeder Bundestagsabgeordnete frei seinem<br />
eigenen Gewissen folgen kann.<br />
Nicht zuletzt bedingt durch den rasanten Fortschritt in<br />
der Medizin und den vielfältigen Folgen des demografischen<br />
Wandels, scheint es mir sinnvoll zu sein, die Frage nach der<br />
Selbstbestimmung am Ende unseres Lebens in zwei unterschiedlichen<br />
Situationszusammenhängen zu betrachten, zu<br />
denen es wiederum eine Vielzahl von ethischen Positionen<br />
gibt. Zum einen geht es um den, nennen wir ihn „klassischen“<br />
individuellen, selbst ausgeübten Suizid einer einzelnen Person,<br />
zum anderen um den begleiteten Suizid, der heute vor<br />
allem als (ärztlich) „assistierter Suizid“ diskutiert wird.<br />
Der „klassische“ Suizid<br />
Wenden wir uns zunächst dem „klassischen Suizid“ zu<br />
und werfen einen kurzen Blick zurück in die Antike. Dabei<br />
stellen wir fest: Schon damals wurde der Suizid kontrovers<br />
diskutiert. Zwei krasse gegenteilige Positionen mögen dies<br />
verdeutlichen. So schrieb der griechische Philosoph Hegesias<br />
von Kyrene, der um 300 v.<br />
Chr. lebte und den Spitznamen der<br />
„Selbstmordprediger“ (der zum Tode<br />
Überredende) hatte, dem Einzelnen<br />
das Recht zu, sich umzubringen<br />
und begründete dieses Recht mit<br />
dem Elend der menschlichen Existenz.<br />
Das menschliche Leben, so<br />
seine radikale Auffassung, habe an sich keinen besonderen<br />
moralischen Wert. Außerdem könne man im Leben niemals<br />
wahre Glückseligkeit erlangen. Er war der Auffassung: So<br />
wie wir selbst bestimmen, wie wir unser Leben gestalten und<br />
einrichten, so muss es auch von unsere Entscheidung abhängen,<br />
wann und wie wir sterben wollen. Seine Ausführungen<br />
müssen dabei derart überzeugend gewesen sein, dass seine<br />
Vorträge in Ägypten verboten wurden, weil sich viele Zuhörer<br />
das Leben nahmen. 2)<br />
Eine völlig gegenteilige Position vertrat Platon (427–<br />
347 v. Chr.). Er hielt den „Selbstmord“ für moralisch<br />
unerlaubt und vertrat die Ansicht: „Man hat auf seinem<br />
Posten auszuharren – Wir ‚gehören‘ nicht uns selbst und<br />
daher dürfen wir nicht über uns selbst verfügen“ – „Aus<br />
dem Leben zu scheiden, das ist so lange nicht erlaubt, bis<br />
der Gott irgend eine Notwendigkeit dazu verfügt hat“. 1) –.<br />
Von daher verlangt die verwerfliche (geglückte!) Tat für<br />
Platon eine Form der Sühne und Bestrafung, die in den<br />
Reinigungs- und Bestattungsriten ihren Ausdruck finden<br />
muss. Der „Selbstmörder“ soll ruhmlos, an einem einsamen<br />
Platz, auf unbebautem und namenlosem Gelände beigesetzt<br />
werden, um damit die ethisch begründeteAblehnung äußerlich<br />
sichtbar werden zu lassen. Diese Aufforderung Platons<br />
ist so etwas wie eine Legitimation und Rechtfertigung des<br />
später aufkommenden Christentums, bis weit in die Neuzeit<br />
hinein, den Leichnam eines Selbstmörders auf keinen Fall<br />
in geweihter Erde beizusetzen, sondern irgendwo, meist außerhalb<br />
der Stadtmauer, namenlos zu verscharren.<br />
Aber auch Sokrates (470–399 v. Chr.) verurteilt den<br />
„Selbstmord“ Für ihn ist der Mensch ein Wesen, … „das sich<br />
in einer Festung befindet, aus der sich zu entfernen ihm nicht<br />
erlaubt ist. Sich selbst töten hieße demnach, sich unerlaubterweise<br />
aus der Festung zu befreien und davonzugehen.“ 1) Aristoteles<br />
(384–322 v. Chr.), ein Schüler Platons, lehnt den<br />
„Selbstmord“ ebenfalls ab, begründet seine Ablehnung aber<br />
nicht wie Platon moralisch-religiös (transzendent) sondern<br />
fragt, ob man sich selbst überhaupt ein Unrecht zufügen könne.<br />
Er ist der Auffassung, da der Staat den Selbstmord nicht<br />
ausdrücklich gebietet, ist er verboten, denn für ihn ist grundsätzlich<br />
alles verboten, was vom Staat nicht ausdrücklich<br />
geboten ist. 1) Außerdem hält Aristoteles den „Selbstmord“<br />
für eine feige Tat: „Den Tod suchen, um der Armut oder<br />
einem Liebeskummer oder sonst etwas Bedrückendem zu<br />
entgehen, das ist nicht tapfer, sondern vielmehr feige. Es ist<br />
Weichlichkeit, sich den Härten des Lebens zu entziehen“. 3)<br />
So etwas wie eine Türöffnerfunktion für das Recht<br />
auf einen selbstbestimmten Tod nahmen die Philosophen<br />
der stoischen Denktradition (Stoa) mit ihrer weitaus liberaleren<br />
Position ein. Für sie können „... Lebensumstände<br />
eintreten, die es angebracht erscheinen lassen, dem Leben<br />
ein Ende zu setzen. Liegen die<br />
Platon: Man hat<br />
auf seinem Posten<br />
auszuharren<br />
entsprechenden Umstände vor,<br />
dann gebietet es, wie die Stoiker<br />
lehrten, gewissermaßen der Logos<br />
selbst, freiwillig das Leben<br />
zu verlassen“. 1) Gründe hierfür<br />
sind: – die Aufopferung für das<br />
Vaterland, – sich der Gewalt und<br />
unsittlichen Handlungen eines Tyrannen entziehen, – wenn<br />
eine langwierige Krankheit den Leib daran hindert, der Seele<br />
als Werkzeug zu dienen, – eine große Armut und Mangel<br />
an Nahrung, – auftretende Geisteskrankheiten.<br />
Halten wir mit diesem kurzen Blick in die Antike fest:<br />
die großen und bekannten Philosophen der damaligen Zeit<br />
lehnten den Suizid, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen,<br />
überwiegend ab. Für sie gab es keine Rechtfertigung<br />
des Menschen, sein Leben selbstbestimmt zu beenden.<br />
Erste Einsprüche kamen von den Stoikern und ihre Einstellung<br />
zu einem „wohlüberlegten Freitod“.<br />
Die Prüfsteine: Gott – Gesellschaft – Natur<br />
Verfolgt man in der Geschichte der abendländischen Philosophie<br />
ihre Auseinandersetzung mit dem Suizid, (wozu<br />
das im Quellennachweis genannte Buch von Dr. Friedhelm.<br />
Decher bestens geeignet ist), so ist zu erkennen, dass &<br />
4/<strong>2014</strong> durchblick 65