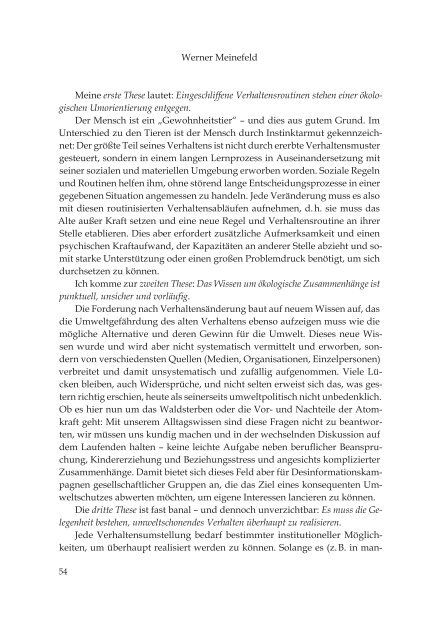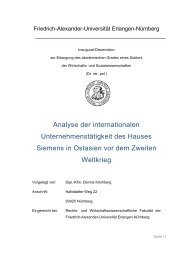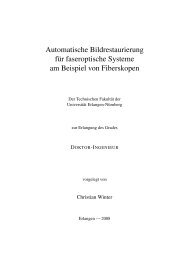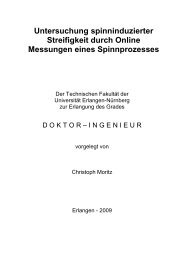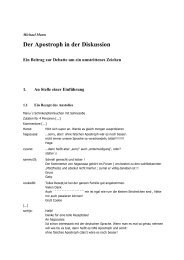Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
54<br />
Werner Meinefeld<br />
Meine erste These lautet: Eingeschliffene Verhaltensroutinen stehen einer ökologischen<br />
Umorientierung entgegen.<br />
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“ <strong>–</strong> und dies aus gutem Grund. Im<br />
Unterschied zu den Tieren ist der Mensch durch Instinktarmut gekennzeichnet:<br />
Der größte Teil seines Verhaltens ist nicht durch ererbte Verhaltensmus ter<br />
ge steuert, sondern in einem langen Lernprozess in Auseinandersetzung mit<br />
seiner sozialen und materiellen Umgebung erworben worden. Soziale Regeln<br />
und Routinen helfen ihm, ohne störend lange Entscheidungsprozesse in einer<br />
gegebenen Situation angemessen zu handeln. Jede Veränderung muss es also<br />
mit diesen routinisierten Verhaltensabläufen aufnehmen, d. h. sie muss das<br />
Alte außer Kraft setzen und eine neue Regel und Verhaltensroutine an ihrer<br />
Stelle etablieren. Dies aber erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit und einen<br />
psychischen Kraftaufwand, der Kapazitäten an anderer Stelle abzieht und somit<br />
starke Unterstützung <strong>oder</strong> einen großen Problemdruck benötigt, um sich<br />
durchsetzen zu können.<br />
Ich komme zur zweiten These: Das Wissen um ökologische Zusammenhänge ist<br />
punktuell, unsicher und vorläufig.<br />
Die Forderung nach Verhaltensänderung baut auf neuem Wissen auf, das<br />
die Umweltgefährdung des alten Verhaltens ebenso aufzeigen muss wie die<br />
mögliche Alternative und deren Gewinn für die Umwelt. Dieses neue Wissen<br />
wurde und wird aber nicht systematisch vermittelt und erworben, sondern<br />
von verschiedensten Quellen (Medien, Organisationen, Einzelpersonen)<br />
verbreitet und damit unsystematisch und zufällig aufgenommen. Viele Lücken<br />
bleiben, auch Widersprüche, und nicht selten erweist sich das, was gestern<br />
richtig erschien, heute als seinerseits umweltpolitisch nicht unbedenklich.<br />
Ob es hier nun um das Waldsterben <strong>oder</strong> die Vor- und Nachteile der Atomkraft<br />
geht: Mit unserem Alltagswissen sind diese Fragen nicht zu beantworten,<br />
wir müssen uns kundig machen und in der wechselnden Diskussion auf<br />
dem Laufenden halten <strong>–</strong> keine leichte Aufgabe neben beruflicher Beanspruchung,<br />
Kindererziehung und Beziehungsstress und angesichts komplizierter<br />
Zusammenhänge. Damit bietet sich dieses Feld aber für Desinformationskampagnen<br />
gesellschaftlicher Gruppen an, die das Ziel eines konsequenten Umweltschutzes<br />
abwerten möchten, um eigene Interessen lancieren zu können.<br />
Die dritte These ist fast banal <strong>–</strong> und dennoch unverzichtbar: Es muss die Gelegenheit<br />
bestehen, umweltschonendes Verhalten überhaupt zu realisieren.<br />
Jede Verhaltensumstellung bedarf bestimmter institutioneller Möglichkeiten,<br />
um überhaupt realisiert werden zu können. Solange es (z. B. in man-