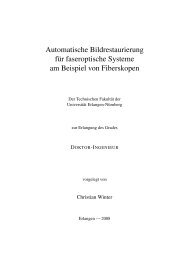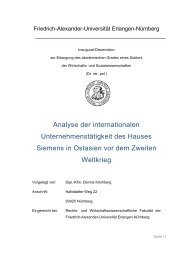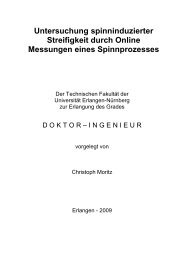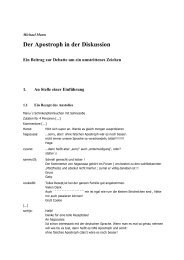Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64<br />
Werner Meinefeld<br />
zu wollen. Nicht nur hatte sich der bisherige Lösungsweg ja bewährt <strong>–</strong> mindestens<br />
ebenso wichtig dürfte sein, dass sich auf der Basis des bisherigen Verhaltens<br />
soziale Strukturen gebildet haben, an die Machtverhältnisse und Besitzstände,<br />
aber auch allgemein Verhaltenssicherheiten und Handlungskompetenzen<br />
gekoppelt sind, die zur Stabilisierung und Beibehaltung des eingeschlagenen<br />
Weges beitragen. Diese Strategie drückt sich in dem bekannten<br />
Spruch aus: „Man wechselt nicht im Fluss die Pferde!“ <strong>–</strong> in der Wissenschaft<br />
spricht man, weniger anschaulich, von der „Pfadabhängigkeit“ von Entscheidungen.<br />
Erlauben Sie mir aber, dieser Strategie des „immer-mehr-von-demselben“<br />
als Königsweg einer Lösung zwei historische Beispiele entgegenzustellen,<br />
die nachdenklich stimmen.<br />
Das erste Beispiel betrifft die Besiedelung Grönlands durch die Wikinger<br />
von etwa 1000 bis 1500. In ihrer Technik der Naturbeherrschung waren<br />
sie den dort schon lange ansässigen Inuit überlegen, und so konnten sie sich<br />
über immerhin 500 Jahre auf dieser Insel festsetzen und ihren aus Europa<br />
mitgebrachten Lebensstil (ihre Ernährungsweise, ihre Sozialstruktur, ihre Religionspraxis)<br />
beibehalten. Die Vegetation auf der Insel war karg, die Vegetationszeit<br />
sehr kurz, aber es gab anfangs genügend Ressourcen, um das gewohnte<br />
Leben am neuen Ort fortzuführen. Doch überforderte dieser Lebensstil<br />
mit seiner Konzentration auf die Viehzucht und der Beibehaltung einer<br />
aufwendigen kirchlichen Organisation das Potential der Insel bei weitem,<br />
und die begrenzte Vegetation und die Endlichkeit des verfügbaren Treibholzes<br />
setzte, zusammen mit einer eintretenden kleinen Eiszeit, der Kultur der<br />
Wikinger auf Grönland ein Ende. 13 Dieses Ende ist natürlich auch auf die Verschlechterung<br />
des Klimas zurückführen <strong>–</strong> aber das erklärt es vermutlich nicht<br />
allein. Die dokumentierten Umstände ihres Lebens auf Grönland weisen auch<br />
darauf hin, dass ihre Lebensart den natürlichen Gegebenheiten nicht angemessen<br />
war, sie aber auch nicht bereit <strong>oder</strong> nicht in der Lage waren, sie zu ändern.<br />
Dies ist ja gerade ein Charakteristikum kultureller Eigenarten: Alternativen<br />
sind schwer zu denken und noch schwerer zu realisieren. Die Inuit mit ihrer<br />
Kultur leben bekanntlich heute noch dort.<br />
Das Verschwinden einer ganzen Kultur im zweiten Beispiel ist denn auch<br />
gar nicht mehr auf eine feindliche Umwelt zurückzuführen. Allem Anschein<br />
13 Vgl. Remmert, 1989, 19f. Siehe auch die ausführlichen Überlegungen in Claus Leggewie/Harald<br />
Welzer, Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und<br />
die Chancen der Demokratie, Frankfurt: Fischer 2009, 84<strong>–</strong>87.