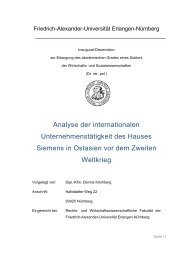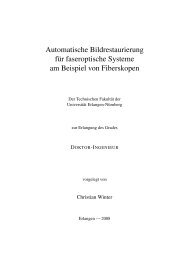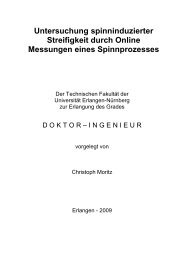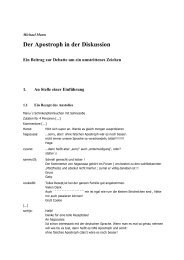Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Alles Theater? Mediengesellschaft als Inszenierungsgesellschaft<br />
in allen Bereichen der Gesellschaft nicht nur toleriert wird, sondern zum guten<br />
Ton gehört. 7<br />
Und was wird dann aus Tugenden wie Echtheit, Haftbarkeit, Authentizität?<br />
Sie müssen der neuen Inszenierungskultur nicht unbe dingt ent gegenstehen,<br />
denn Authentizität und Inszenierung sind durchaus miteinander<br />
vereinbar. In seinem griechischen Ursprung geht der Authentizitätsbegriff<br />
auf die Idee der Urheberschaft zurück, und tatsächlich transportiert diese<br />
Idee treffend die verschiedenen Konnotationen, die mitschwingen, wenn<br />
heute von Authentizität die Rede ist. Die Frage nach der Authentizität eines<br />
Auftritts entscheidet sich daran, ob man den Akteur tatsächlich als Urheber<br />
hinter seinen Worten und Handlungen sieht. Obwohl Gerhard Schröder<br />
von einer breiten Öffentlichkeit als raffinierter und trickreicher Selbstdarsteller<br />
wahrgenommen wurde, konnte man ihn in seinem Auftreten zugleich für<br />
„authentisch“ halten. Dieser Eindruck ergab sich dadurch, dass er stets Regisseur<br />
seiner Inszenierungen zu sein schien. Schröder wahrte ironische Distanz,<br />
zeigte sich über die Erwartungen seines Publikums im Bilde und wirkte<br />
so, als hätte er Spaß daran, für öffentliche Auftritte eine unterhaltsame Form<br />
zu finden. Man wusste durchaus, dass Schröder sich publikumswirksam in<br />
Szene setzte, aber so lange man ihm zutraute, diese Inszenierungen selbst unter<br />
Kontrolle zu haben, taten sie seiner Authentizität keinen Abbruch.<br />
Dieselbe Abgeklärtheit gegenüber politischer Selbstdarstellung ist auch in<br />
Bezug auf Barack Obama beobachtbar. Natürlich weiß jeder um die „Show“,<br />
die seine öffentlichen Auftritte umgibt. Niemand, der die US-amerikanischen<br />
Wahlkämpfe verfolgt, käme auf die Idee, den Inszenierungscharakter<br />
von Obamas Veranstaltungen zu unterschätzen. Schon als Kandidat wurde<br />
Obama nicht dafür geliebt, dass man ihn für direkt und offenherzig gehalten<br />
hätte. Eher verhielt es sich umgekehrt: Die Inszeniertheit seines Auftretens<br />
wurde wahrgenommen, aber man schätzte an Obama gerade die Perfektion<br />
und Lässigkeit eben dieser Inszenierungen. 8 Tatsächlich können Politiker<br />
heute aus der Qualität ihrer Inszenierungen Kompetenzzuschreibungen<br />
7 Diese Überlegungen finden sich in seinem Keynote-Vortrag auf dem 10. Kongress<br />
der Gesellschaft für Theaterwissenschaft in Mainz am 29. Oktober 2010 unter dem<br />
Titel „Selbst und Selbstwiderspruch“, noch unveröffentlicht.<br />
8 Vgl. dazu Matthias Warstat, 2010: Obamas Körper. Performative Aspekte politischer<br />
Rhetorik, in: Jürgen Weibler (Hg.), Barack Obama und die Macht der Worte,<br />
Wiesbaden, S. 173<strong>–</strong>189.<br />
95