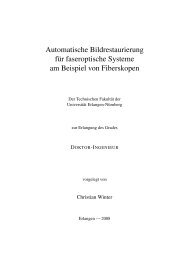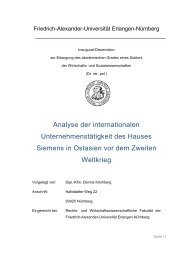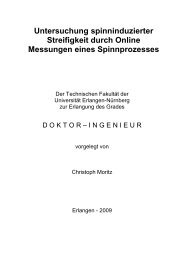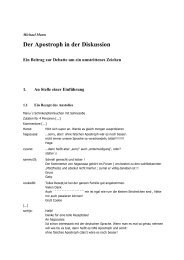Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
82<br />
Matthias Warstat<br />
Sofern es keine massiven Störungen gibt, landet die Botschaft beim Empfänger,<br />
der die Zeichen decodieren kann und die Nachricht entsprechend verstehen<br />
wird. Als Komplikation kommt aber hinzu, dass sich Sender und Empfänger<br />
nicht unbedingt am selben Ort befinden. Wie kann also die Nachricht<br />
über eine räumliche Distanz hinweg zum Empfänger gelangen? Dazu muss<br />
es eine dritte Instanz geben, die die räumliche <strong>oder</strong> auch zeitliche Kluft überwindet<br />
und die Vermittlung gewährleistet. Und diese dritte Instanz ist nach<br />
dem traditionellen Sender-Empfänger-Modell eben das Medium. Man stellt<br />
sich das Medium vor wie einen Kanal, einen Informationskanal, der vermittelnd<br />
zwischen Sender und Empfänger geschaltet ist.<br />
Das klingt einleuchtend und rechtfertigt es durchaus, unter Medien alles<br />
das zu verstehen, was eine vermittelnde Funktion übernimmt. Dies wäre ein<br />
funktional konturierter Medienbegriff: Ein Medium ist das, was die Funktion<br />
der Vermittlung erfüllt. Medien dienen der Vermittlung, sie sind das Vermittelnde.<br />
Gegen diesen Medienbegriff richtet sich Dieter Mersch. Er beruft sich dabei<br />
auf den lateinischen Ursprung des Begriffs: Das Wort „Medium“ bedeutet<br />
im Lateinischen ja nicht „das Vermittelnde“, sondern zunächst einmal einfach<br />
„die Mitte“. Diese ursprüngliche Bedeutung macht Mersch stark: Das<br />
Medium ist die Mitte. Das Medium ist das in der Mitte Befindliche, es ist in<br />
der Mitte, es ist dazwischen. Wir haben es mit einer Instanz zu tun, die buchstäblich<br />
zwischen dem Sender und dem Empfänger steht. Auf den ersten Blick<br />
scheint sich diese Definition nicht wesentlich von der funktionalen Definition<br />
zu unterscheiden, die in Medien einfach das Vermittelnde sieht. Bei näherem<br />
Hinsehen zeigt sich aber doch, dass es einen großen Unterschied macht, ob<br />
man von dem Vermittelnden spricht <strong>oder</strong> <strong>–</strong> wie Mersch <strong>–</strong> von dem, das dazwischen<br />
steht. Der Unterschied besteht darin, dass das, was in der Mitte<br />
steht, was dazwischen steht, nicht nur eine Vermittlung schafft, sondern immer<br />
auch eine Barriere ist. Das ist der Kern dessen, was Mersch einen negativen<br />
Medienbegriff nennt. Medien sind immer auch eine Barriere. Indem sie<br />
zwei Orte miteinander verbinden, bilden sie zwischen diesen Orten zugleich<br />
ein Hindernis. 2<br />
Man kann das am Beispiel des Telefons veranschaulichen. Das Te lefon,<br />
ein mittlerweile schon altehrwürdig anmutendes Medium, macht es uns ei-<br />
2 Vgl. auch Dieter Mersch, 2006: Medientheorien zur Einführung, Hamburg, S. 219<strong>–</strong><br />
228.