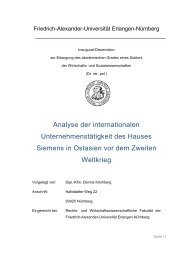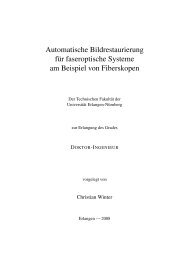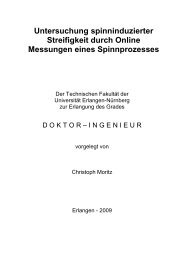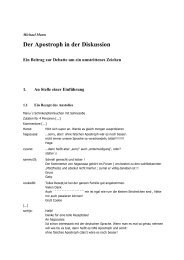Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Klimawandel – Faktum oder Spuk? - OPUS - Friedrich-Alexander ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Alles Theater? Mediengesellschaft als Inszenierungsgesellschaft<br />
men und anerkannt zu werden. Aus den Vereinigten Staaten hört man, dass<br />
bei Neueingebürgten oft ein besonders demonstrativer Umgang mit den nationalen<br />
Symbolen, etwa der Flagge <strong>oder</strong> der Hymne, auffällig ist. Dieses demonstrative<br />
Verhalten zielt offenkundig darauf ab, die neu angenommene nationale<br />
Identität von den Mitbürgern auch bestätigt zu bekommen. Der Ort,<br />
wo sich Identitäten zu bewähren haben, wo sie Stabilität gewinnen können<br />
<strong>oder</strong> überhaupt erst wirklich werden, ist also der Blick des Mitmenschen, des<br />
anderen, der sich in seinem Verhalten auf die wahrgenommene Identität bezieht.<br />
Daraus resultiert eine strukturelle Abhängigkeit der eigenen Identität<br />
von der Wahrnehmung des anderen. Alle Bemühungen um Identitätskonstruktion<br />
nutzen wenig, wenn sie in den Blicken anderer Menschen keine Bestätigung<br />
finden.<br />
Genau an diesem Punkt kommen Inszenierungen ins Spiel. Denn die Blicke<br />
der anderen können beeinflusst werden. Wir können etwas, eine Sache,<br />
ein Ding <strong>oder</strong> eine Handlung, so herrichten, dass es von den anderen in bestimmter<br />
Weise wahrgenommen wird. Etwas für die Wahrnehmung der anderen<br />
herrichten <strong>–</strong> das ist die einfachste theaterwissenschaftliche Definition<br />
für den Begriff der Inszenierung. Inszenierung heißt: etwas für die Wahrnehmung<br />
einrichten <strong>oder</strong> herrichten.<br />
Von dieser Definition ausgehend wird deutlich, dass auch Identitäten inszeniert<br />
werden können <strong>oder</strong> sogar müssen. Es ist uns nicht gleichgültig, welcher<br />
Eindruck von uns in der Wahrnehmung des anderen entsteht. Der Philosoph<br />
Helmuth Plessner („Die Stufen des Organischen und der Mensch“, 1928)<br />
hat in diesem Zusammenhang von der exzentrischen Positionalität des Menschen,<br />
Abständigkeit des Menschen von sich selbst gesprochen: Weil wir uns<br />
beim Handeln immer auch mit den Augen des anderen sehen, das heißt einen<br />
zur Beobachtung nötigen Abstand zu uns selbst einzunehmen in der Lage<br />
sind, entwickeln wir das Bedürfnis, unser Handeln und Erscheinen für den<br />
Blick des anderen herzurichten und in bestimmter Weise auszugestalten. Solange<br />
wir immer auch unser eigener Zuschauer sind <strong>–</strong> und diese Selbstreflexivität<br />
ist für den Menschen nach Plessner kaum vermeidbar <strong>–</strong> kommen wir<br />
nicht umhin, unser Erscheinungsbild zu inszenieren und uns dabei der Muster<br />
bestimmter Identitätskonstrukte zu bedienen.<br />
Der innere Zusammenhalt einer Gesellschaft ist an Identitäten gebunden,<br />
die den Einzelnen mit einer größeren Zahl von Menschen zusammenführen.<br />
Identitäten sind aber nicht einfach da. Sie werden im Sprechen und Handeln<br />
hervorgebracht. Dieses Sprechen und Handeln ist in gewissem Maße steuer-<br />
91