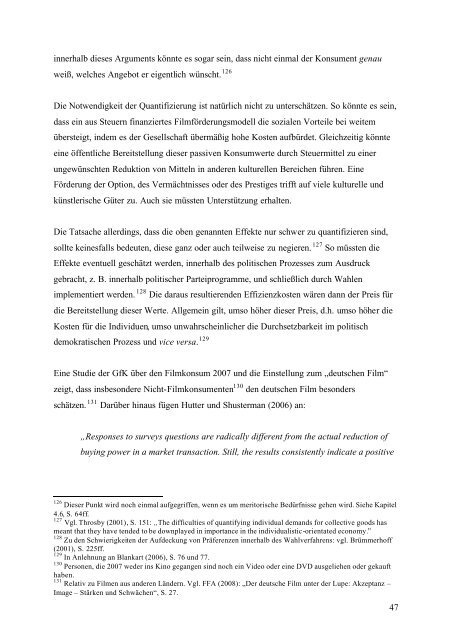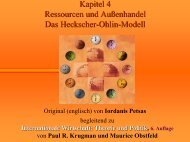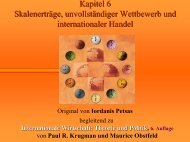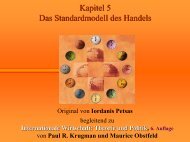Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
innerhalb dieses Arguments könnte es sogar sein, dass nicht einmal der Konsument genau<br />
weiß, welches Angebot er eigentlich wünscht. 126<br />
Die Notwendigkeit der Quantifizierung ist natürlich nicht <strong>zu</strong> unterschätzen. So könnte es sein,<br />
dass ein aus Steuern finanziertes Filmförderungsmodell die sozialen Vorteile bei weitem<br />
übersteigt, indem es der Gesellschaft übermäßig hohe Kosten aufbürdet. Gleichzeitig könnte<br />
eine öffentliche Bereitstellung dieser passiven Konsumwerte durch Steuermittel <strong>zu</strong> einer<br />
ungewünschten Reduktion von Mitteln in anderen kulturellen Bereichen führen. Eine<br />
Förderung der Option, des Vermächtnisses oder des Prestiges trifft auf viele kulturelle und<br />
künstlerische Güter <strong>zu</strong>. Auch sie müssten Unterstüt<strong>zu</strong>ng erhalten.<br />
Die Tatsache allerdings, dass die oben genannten Effekte nur schwer <strong>zu</strong> quantifizieren sind,<br />
sollte keinesfalls bedeuten, diese ganz oder auch teilweise <strong>zu</strong> negieren. 127 So müssten die<br />
Effekte eventuell geschätzt werden, innerhalb des politischen Prozesses <strong>zu</strong>m Ausdruck<br />
gebracht, z. B. innerhalb politischer Parteiprogramme, und schließlich durch Wahlen<br />
implementiert werden. 128 Die daraus resultierenden Effizienzkosten wären dann der Preis für<br />
die Bereitstellung dieser Werte. Allgemein gilt, umso höher dieser Preis, d.h. umso höher die<br />
Kosten für die Individuen, umso unwahrscheinlicher die Durchsetzbarkeit im politisch<br />
demokratischen Prozess und vice versa. 129<br />
Eine Studie der GfK über den Filmkonsum 2007 und die Einstellung <strong>zu</strong>m „deutschen Film“<br />
zeigt, dass insbesondere Nicht-Filmkonsumenten 130 den deutschen Film besonders<br />
schätzen. 131 Darüber hinaus fügen Hutter und Shusterman (2006) an:<br />
„Responses to surveys questions are radically different from the actual reduction of<br />
buying power in a market transaction. Still, the results consistently indicate a positive<br />
126 Dieser Punkt wird noch einmal aufgegriffen, wenn es um meritorische Bedürfnisse gehen wird. Siehe <strong>Kapitel</strong><br />
4.6, S. 64ff.<br />
127 Vgl. Throsby (2001), S. 151: „The difficulties of quantifying individual demands for collective goods has<br />
meant that they have tended to be downplayed in importance in the individualistic-orientated economy.”<br />
128 Zu den Schwierigkeiten der Aufdeckung von Präferenzen innerhalb des Wahlverfahrens: vgl. Brümmerhoff<br />
(2001), S. 225ff.<br />
129 In Anlehnung an Blankart (2006), S. 76 und 77.<br />
130 Personen, die 2007 weder ins Kino gegangen sind noch ein Video oder eine DVD ausgeliehen oder gekauft<br />
haben.<br />
131 Relativ <strong>zu</strong> Filmen aus anderen Ländern. Vgl. FFA (2008): „Der deutsche Film unter der Lupe: Akzeptanz –<br />
Image – Stärken und Schwächen“, S. 27.<br />
47