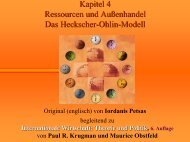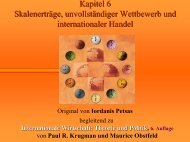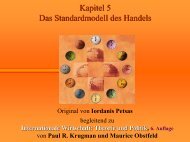Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.4.1 Alternative Formen der Preisset<strong>zu</strong>ng<br />
Ein wichtiger Punkt bezüglich der Höhe des Preises war in diesem Zusammenhang die Höhe<br />
der Entwicklungskosten relativ <strong>zu</strong> den übrigen Kosten. Diesbezüglich wäre <strong>zu</strong>m Beispiel ein<br />
relativ geringerer Preis für gering budgetierte Filme an der Kinokasse denkbar. 150 Eventuell<br />
könnte angeführt werden, dass ein niedriger Ticketpreis <strong>zu</strong>r Nichtdeckung der Kosten seitens<br />
des Kinobetreibers führt. Doch da die Kinobetreiber ihre Umsätze in der Regel durch den<br />
Verkauf so genannter concession goods wie Popcorn und Getränke und durch Kinowerbung<br />
generieren, ist es innerhalb dieses Arguments <strong>zu</strong>nächst nicht nachvollziehbar, warum am<br />
starren System der festen Kinopreise, wie es in fast allen Filmwirtschaften der Fall ist,<br />
festgehalten werden sollte, <strong>zu</strong>mal dann nicht, wenn kleinere Filme mit einem geringen Budget<br />
in derselben Arena antreten müssen wie <strong>zu</strong>m Beispiel die Blockbuster. Deren regelmäßig<br />
enormer Werbeaufwand bedeutet grundsätzlich einen relativen Vorteil in Be<strong>zu</strong>g auf die<br />
Informationsverteilung bei den Konsumenten.<br />
Ein geringerer Preis für „kleine Filme“ (= gering budgetierte Filme) hätte möglicherweise<br />
jedoch auch negative Signalwirkungen auf den Kinobesucher, indem dieser ihm eine<br />
schlechtere Qualität signalisiert. Wenn an<strong>zu</strong>nehmen ist, dass „kleine Filme“ eher von<br />
Besserverdienenden konsumiert werden, würden <strong>zu</strong>dem mit einem geringeren Preis<br />
möglicherweise gerade diejenigen Individuen bevor<strong>zu</strong>gt bzw. subventioniert, die ohnehin<br />
schon über ein höheres Einkommen verfügen. Unter diesen Umständen wäre möglicherweise<br />
eine genau entgegengesetzte Preisset<strong>zu</strong>ng volkswirtschaftlich effizienter. Um das <strong>zu</strong><br />
verstehen, möchte ich in diesem Zusammenhang das Prinzip der Ramsey-Preise in einem<br />
kurzen und stark vereinfachten Beispiel ausführen: 151<br />
4.4.2 Ramsey-Preise: Ein Beispiel<br />
Es sei angenommen, es gäbe zwei Filmgruppen, Hitfilme und Kunstfilme, die unterschiedliche<br />
Preiselastizitäten der Nachfrage aufweisen. Dabei soll gelten, dass die Nachfrage nach<br />
Hitfilmen preiselastischer ist als für Filme, die allgemein schwieriger <strong>zu</strong>gänglich sind und die<br />
150 So auch der Vorschlag von Christoph Müller, Geschäftsführer des deutschen Produktions- und<br />
Verleihunternehmens Senator, in einem Interview in der Branchenzeitung Blickpunkt:Film in Hinblick auf<br />
„kleine Filme“ mit einem geringeren „production value“. Vgl. Blickpunkt:Film (2007), Nr. 49/07, S. 21.<br />
151 Vgl. z.B. Brümmerhoff (2001), S. 71, Blankart (2006), S. 492f., Baumol (2006), S. 352f.<br />
53