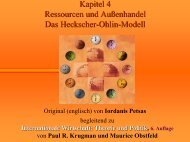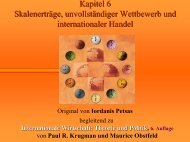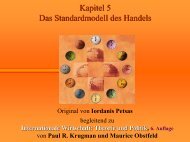Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„The distinction between private and public or social goods arises from the mode in<br />
which benefits become available, that is, rival in the one and non-rival in the other<br />
case.[…]. But whether met through a market or political process, both choices and the<br />
normative evaluation of outcomes rest squarely on the premise of individual<br />
preference. […] The concept of merit (or, for that matter, of demerit) goods questions<br />
that premise.” 185<br />
Einzig und allein der Staat, die dort handelnden Akteure oder andere Institutionen befinden,<br />
ein bestimmtes Gut oder eine bestimmte Dienstleistung müsse mehr bereitgestellt werden<br />
bzw., vice versa, <strong>zu</strong>rückgedrängt werden (sog. demeritorische Güter). Das Konzept ist<br />
umstritten, weil es letztlich auf einer ex post willkürlichen Meinung basiert. Wenn nicht<br />
geklärt wird, was verdienstwürdig bedeutet, so könnte jeder Staatseingriff mit diesem<br />
Argument <strong>zu</strong> rechtfertigen sein. Aber trifft das auf den Film <strong>zu</strong>? Und wenn ja, auf alle oder<br />
auf nur einige wenige? Und ist solch eine Beurteilung dann nicht abhängig von den jeweils an<br />
der Regierung Beteiligten und deren subjektivem Urteil?<br />
„Bei öffentlichen Gütern kommen (prinzipiell) die im Prozess demokratischer<br />
Willensbildung offen gelegten Präferenzen […] <strong>zu</strong>r Geltung, wohingegen bei<br />
meritorischen Gütern der Eingriff gezielt gegen die (als verzerrt geltenden)<br />
Präferenzen verläuft […].“ 186<br />
Die Dissonanz im Falle der meritorischen Bedürfnisse von den am Markt offenbarten<br />
Bedürfnissen der Konsumenten muss sich aber nicht zwangsläufig in einem willkürlichen<br />
Zwangskonsum bzw. Verbot begründen, noch müssen sie zwingend das Prinzip der<br />
Konsumentensouveränität per se untergraben. So gibt es Varianten, die sich innerhalb eines<br />
normativen Argumentationsrahmens für eine staatliche Intervention bewegen. 187<br />
4.6.1. Am Markt nicht aufzeigbare Präferenzen: community values<br />
Unter anderem hat Musgrave (1987) selbst den Bogen <strong>zu</strong> den weiter oben besprochenen non-<br />
user values geschlagen. Hier wurde angenommen, dass die Gesellschaft durchaus eine höhere<br />
185 Vgl. Musgrave (1987), S. 126.<br />
186 Vgl. Brümmerhoff (2001), S. 113.<br />
187 Vgl. z. B. Musgrave (1987), S. 127ff.; Throsby (2001), S. 141; Brümmerhoff (2001), S. 113. Dort finden sich<br />
<strong>zu</strong>m Teil auch noch weitere Argumente, jedoch möchte ich mich hier angesichts des beschränkten Umfangs der<br />
Arbeit auf lediglich zwei Varianten konzentrieren.<br />
65