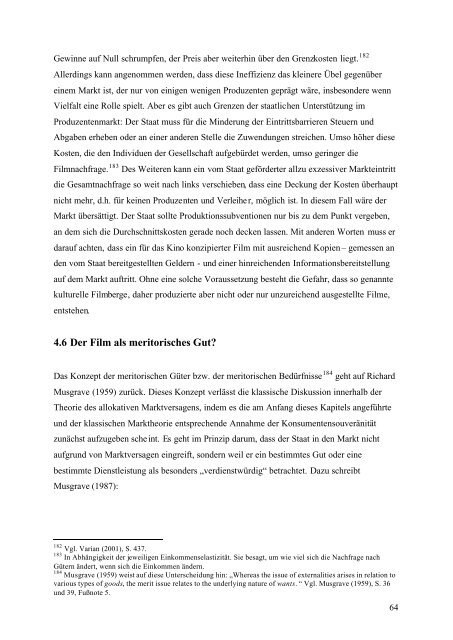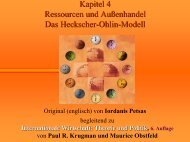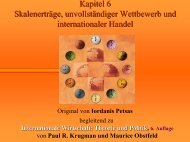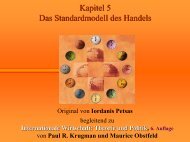Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Kapitel 1 - Humboldt-Universität zu Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gewinne auf Null schrumpfen, der Preis aber weiterhin über den Grenzkosten liegt. 182<br />
Allerdings kann angenommen werden, dass diese Ineffizienz das kleinere Übel gegenüber<br />
einem Markt ist, der nur von einigen wenigen Produzenten geprägt wäre, insbesondere wenn<br />
Vielfalt eine Rolle spielt. Aber es gibt auch Grenzen der staatlichen Unterstüt<strong>zu</strong>ng im<br />
Produzentenmarkt: Der Staat muss für die Minderung der Eintrittsbarrieren Steuern und<br />
Abgaben erheben oder an einer anderen Stelle die Zuwendungen streichen. Umso höher diese<br />
Kosten, die den Individuen der Gesellschaft aufgebürdet werden, umso geringer die<br />
Filmnachfrage. 183 Des Weiteren kann ein vom Staat geförderter all<strong>zu</strong> exzessiver Markteintritt<br />
die Gesamtnachfrage so weit nach links verschieben, dass eine Deckung der Kosten überhaupt<br />
nicht mehr, d.h. für keinen Produzenten und Verleiher, möglich ist. In diesem Fall wäre der<br />
Markt übersättigt. Der Staat sollte Produktionssubventionen nur bis <strong>zu</strong> dem Punkt vergeben,<br />
an dem sich die Durchschnittskosten gerade noch decken lassen. Mit anderen Worten muss er<br />
darauf achten, dass ein für das Kino konzipierter Film mit ausreichend Kopien – gemessen an<br />
den vom Staat bereitgestellten Geldern - und einer hinreichenden Informationsbereitstellung<br />
auf dem Markt auftritt. Ohne eine solche Vorausset<strong>zu</strong>ng besteht die Gefahr, dass so genannte<br />
kulturelle Filmberge, daher produzierte aber nicht oder nur un<strong>zu</strong>reichend ausgestellte Filme,<br />
entstehen.<br />
4.6 Der Film als meritorisches Gut?<br />
Das Konzept der meritorischen Güter bzw. der meritorischen Bedürfnisse 184 geht auf Richard<br />
Musgrave (1959) <strong>zu</strong>rück. Dieses Konzept verlässt die klassische Diskussion innerhalb der<br />
Theorie des allokativen Marktversagens, indem es die am Anfang dieses <strong>Kapitel</strong>s angeführte<br />
und der klassischen Marktheorie entsprechende Annahme der Konsumentensouveränität<br />
<strong>zu</strong>nächst auf<strong>zu</strong>geben scheint. Es geht im Prinzip darum, dass der Staat in den Markt nicht<br />
aufgrund von Marktversagen eingreift, sondern weil er ein bestimmtes Gut oder eine<br />
bestimmte Dienstleistung als besonders „verdienstwürdig“ betrachtet. Da<strong>zu</strong> schreibt<br />
Musgrave (1987):<br />
182<br />
Vgl. Varian (2001), S. 437.<br />
183<br />
In Abhängigkeit der jeweiligen Einkommenselastizität. Sie besagt, um wie viel sich die Nachfrage nach<br />
Gütern ändert, wenn sich die Einkommen ändern.<br />
184<br />
Musgrave (1959) weist auf diese Unterscheidung hin: „Whereas the issue of externalities arises in relation to<br />
various types of goods, the merit issue relates to the underlying nature of wants. “ Vgl. Musgrave (1959), S. 36<br />
und 39, Fußnote 5.<br />
64