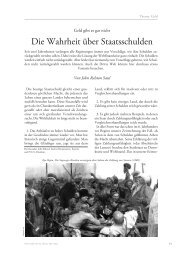die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
katholischen Kirchenfürsten Kardinal<br />
Michael (von) Faulhaber, verglichen.<br />
Für Faulhaber, gestorben 1952, wurde<br />
sofort – der Münchenkenner kann es<br />
noch heute bestätigen – eine nicht unansehnliche<br />
Münchner Innenstadtstraße<br />
in Kardinal-Faulhaber-Straße umbenannt.<br />
Faulhaber sofort höchst prominent<br />
geehrt – und wo bleibt da im pari tä -<br />
ti sche n Denken der Zeit <strong>die</strong> Evan gelische<br />
Kirche Bayerns? Wohl möglich, dass da<br />
mancher eine Lücke, zumindest eine of -<br />
fene Stelle verspürte.<br />
Genau zu <strong>die</strong>ser Zeit war der Sozialdemokrat<br />
Wilhelm Hoegner, Chef der sog.<br />
Viererkoalition, bayerischer Ministerpräsident.<br />
Er hatte schon bald nach dem<br />
Krieg versichert, dass „jeder gute Christ<br />
ohne Bedenken Sozialdemokrat und<br />
jeder Sozialdemokrat … ohne Bedenken<br />
gläubiger Christ sein“ könne, und<br />
behielt <strong>die</strong>se Meinung stets bei. Auch<br />
hatte er durch einen damals eher ungewöhnlichen<br />
Schritt, nämlich einen parteilosen<br />
Vizepräsidenten des Evangelischen<br />
Landeskirchenamtes zum<br />
Staats sekretär zu machen, ganz offenbar<br />
zu zeigen versucht, dass sich <strong>die</strong> Evangelische<br />
Kirche nicht nur von der CSU vertreten<br />
fühlen musste.<br />
Was lag bei einer solchen politischen<br />
Gefühlslage näher, als dem soeben ver-<br />
Heftkritik<br />
Unaufgeregt anspruchsvoll<br />
DIE GAZETTE: Viel Text, wenige Bilder, keine<br />
hochgekochten Sensationen<br />
Anders als üblich gab es DIE GAZETTE zunächst<br />
online, seit 1998, und erst sechs Jahre später auch<br />
gedruckt. Und anders als viele sonstigen Zeit -<br />
schriftengründungen hat <strong>die</strong> Münchner, vom Literaturwissenschafter<br />
Fritz R. Glunk gegründete<br />
Vierteljahresschrift nicht blätternde Zuschauer als<br />
Zielgruppe im Sinn, sondern denkende Leser. Das<br />
bedeutet auf 106 Seiten viel Text, wenige Bilder,<br />
keine hochgekochten Sensationen.<br />
„Eigentlich vollkommen unverkäuflich“, wie der<br />
Journalist Peter Littger in der internen „Heftkritik“<br />
der aktuellen Nummer noch eins nachlegt. Er meint<br />
das als Kompliment, und es ist ihm beizustimmen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Gazette</strong> ist das, was viele Diskurs-Plattformen<br />
nur simulieren (Littger erwähnt etwa das von ihm<br />
mitbegründete Cicero), ein Diskussionsorgan im<br />
altmodischen Sinn, anspruchsvoll und nicht ohne<br />
storbenen protestantischen Oberhirten<br />
Bayerns auch von seiten der Landeshauptstadt,<br />
dazu noch unter Führung<br />
derselben Partei wie <strong>die</strong> Staatsregierung,<br />
<strong>die</strong> gleiche Ehre zuteil werden lassen wie<br />
wenige Jahre zuvor Faulhaber? Den Zeitungen<br />
und Nachrufen jener Zeit ist zu<br />
entnehmen, dass Bischof Hans Meiser<br />
den Münchnern und Bayern in der letzten<br />
Phase seines Lebens vor allem wegen<br />
seines bei aller Kritik der Biographen<br />
offenbar hohen Charismas im Gedächtnis<br />
blieb, und <strong>die</strong> subjektive Erschütterung<br />
so manches Berichts ist auf ihre<br />
Weise durchaus glaubwürdig. Und gar<br />
nicht zu verschweigen ist, dass eine solche<br />
Ehrung auch für <strong>die</strong> Ehrenden politischen<br />
Ertrag versprach und – wie am<br />
damaligen Echo zu sehen – keineswegs<br />
nur versprach.<br />
<strong>Die</strong> zumindest partiellen Verstrickungen<br />
Meisers in das Un rechtsregime der<br />
NS-Zeit mögen bei der damaligen Be -<br />
wertung eine nur geringe Rolle gespielt<br />
haben, und damit befand er sich zu jener<br />
Zeit, 1957, zweifellos in wenn nicht<br />
guter, so doch gro ßer Zeitgenossenschaft.<br />
<strong>Die</strong>s alles ist, retrospektiv betrachtet,<br />
freilich nicht schön. Aber wann ist Ge -<br />
schichte schon „schön“? Und mit welcher<br />
Legitimation machen wir Spätergebore-<br />
nen uns an heischig, Ge schichte durch<br />
Umschreiben, Wegretuschieren wie<br />
dem Entfernen eines Namens von einer<br />
Straßentafel, zu „verschönern“?<br />
Aber damals, 1957, in einer Welt, in<br />
der <strong>die</strong> Überlebenden von 1945 gerade<br />
auf der Höhe ihrer Schaffenskraft waren<br />
und <strong>die</strong> Mitte der Gesellschaft bildeten,<br />
war es politisch zumindest nicht unvorteilhaft,<br />
für den, nach damaliger Lesart,<br />
ver<strong>die</strong>nten Kirchenmann auf solche<br />
Weise Verständnis zu zeigen und <strong>die</strong>s<br />
über <strong>die</strong> Benennung symbolisch zu<br />
bekräftigen.<br />
So wie der Beschluss einer hochweisen<br />
Obrigkeit 2007 den Beifall vieler gefunden<br />
hat, <strong>die</strong> wohlmeinend sind, aber ent -<br />
weder nicht <strong>die</strong> Voraussetzungen oder<br />
nicht <strong>die</strong> Zeit haben, solche alten Akten<br />
nachzulesen; es ist der Beifall da rüber,<br />
dass man sich hier von einem Stück Vergangenheit<br />
befreit, das viele von uns<br />
anfangen, als Makel zu empfinden.<br />
Verschönerung aber sollte auf Lebensbereiche<br />
wie auf das Aufstellen von<br />
Ruhebänkchen durch den Verschönerungsverein<br />
beschränkt bleiben. Denn<br />
schon als Selbstverschönerung, vulgo<br />
Kosmetik, wird sie in vielem fragwürdig.<br />
Den Spiegel reichen wir gerne.<br />
Anton Stahlberg<br />
Überraschungen. Mag man Julian Nida-Rümelins<br />
Beitrag über „Gerechtigkeit in Europa“ noch als Teil<br />
des etablierten bundesrepublikanischen Dialogs<br />
sehen, so fällt der kluge und zynische Beitrag des<br />
kenianischen Autors Binjawanga Wainaina über <strong>die</strong><br />
wohlgemeinten Initiativen der Ersten Welt zur Rettung<br />
der Dritten („Biogas, Aufziehradio, One Laptop<br />
Per Child“) schon aus dem Rahmen. „Der Internationale<br />
Währungsfonds wird dazu lächeln.“<br />
Man nehme dazu <strong>die</strong> Aufzählung von Matthias<br />
Horx' 100 Top-Trends von 2004, <strong>die</strong> sich von selbst<br />
verreißt, oder Zé do Rock, wie er in seinem quasideutschen<br />
Idiom Witziges und Ernstes aus Kuba<br />
berichtet, oder <strong>die</strong> brisante Rekonstruktion eines<br />
Geheimtreffens von Dissidenten und Regimespitzen<br />
mitten in der DDR, 1976 und kurz nach der<br />
Ausweisung Biermanns: Das Ergebnis ist rund,<br />
spannend und formal in einer unaufgeregten<br />
Ästhetik zwischen dem seligen Transatlantik und<br />
Datum angesiedelt. Ein Gewinn.<br />
(Michael Freund/DER STANDARD, Wien; Printausgabe,<br />
6. November 2007)<br />
105