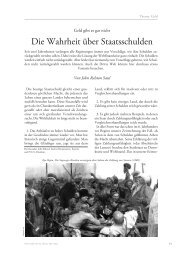die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Klimawandel<br />
Damit hatte Humboldt zu seiner Zeit zweifellos<br />
vollkommen recht: Im Jahr 1843 beeinflusste <strong>die</strong><br />
Zivilisation in der Tat den „Typus der Klimate“<br />
noch nicht merklich. Seither jedoch ist <strong>die</strong> Welt -<br />
bevölkerung von 1,262 Milliarden auf 6,641<br />
Milliarden um mehr als das Fünffache angewach -<br />
sen. <strong>Die</strong> Industria li sierung, und vor allem <strong>die</strong><br />
Emission der Ausstoß an CO 2 – dessen Wirkung<br />
Humboldt noch nicht kennen konnte – hat sich<br />
inzwischen als bedrohlicher Klimafaktor erwiesen.<br />
Sein weltweiter durch Menschen verursachter<br />
Ausstoß ist seit Humboldts Be ob achtung um 1840<br />
bis heute auf das Mehrtausendfache angewachsen.<br />
<strong>Die</strong> Gesamtkonzentration von CO 2 in der Atmo -<br />
sphäre stieg seither von etwa 280 ppm auf etwa<br />
385 ppm an.<br />
Vermutlich hat kein anderer Wissenschaftler<br />
zuvor bis zu <strong>die</strong>sem Zeitpunkt eine derartig<br />
scharfsinnige Analyse des anthropogenen Einflusses<br />
auf das Klima geliefert. Sie ist Bestandteil einer<br />
umfassenden Wissenschaftskonzeption Alexander<br />
von Humboldts, <strong>die</strong> im Folgenden kurz erläutert<br />
werden soll.<br />
Alexander von Humboldt gilt heute als<br />
Vordenker der modernen Ökologie. Zwar kannte er<br />
den Begriff, den Ernst Haeckel erst 1866, kurz nach<br />
Humboldts Tod, geprägt hatte, noch nicht, aber er<br />
lieferte bereits 1799 hierfür eine korrekte Defini -<br />
tion: „Mein eigentlicher, einziger Zweck“, schrieb<br />
er damals, „ist das Zusammen- und Ineinander-<br />
Weben aller Naturkräfte zu untersuchen, den<br />
Einfluss der to ten Natur auf <strong>die</strong> belebte Tier- und<br />
Pflanzenschöpfung.“ Später, im Kosmos spricht er<br />
vom „ewigen Haushalte der Natur“. Er betrachtet<br />
sie als „eine allgemeine Verkettung nicht in einfach<br />
linearer Richtung, sondern in netzartig verschlun -<br />
genem Ge webe.“<br />
Heute bezeichnet man als Ökologie „ein Teilgebiet<br />
der Biologie, welches sich mit den Wechsel -<br />
beziehungen der Organismen untereinander und<br />
mit ihrer abiotischen Umwelt beschäftigt“<br />
(Wikipedia). Allerdings ging Humboldt bereits<br />
damals über <strong>die</strong>se enge Definition hinaus: zum<br />
einen, weil sich sein wissenschaftlicher Ansatz nicht<br />
auf eine einzige Disziplin wie <strong>die</strong> Biologie<br />
reduzieren lässt, zum anderen, weil der Mensch in<br />
Humboldts Wissenschaftskonzeption als ein<br />
politisch handelndes und mit der Umwelt inter -<br />
agierendes Wesen immer eine zentrale Rolle spielt.<br />
In einem weiteren Sinn allerdings wird der Begriff<br />
Ökologie oder „ökologisch“ heute in um welt poli -<br />
tischen Zusammenhängen verwendet. In <strong>die</strong>sem<br />
Kontext ist es durchaus sinnvoll, Humboldt als<br />
Ökologen oder Vordenker der Nachhaltigkeit zu<br />
bezeichnen. Auf eine bestimmte Disziplin jedoch<br />
kann man Humboldts Ansatz nicht reduzieren. Wie<br />
der Potsdamer Literaturwissenschaftler Ottmar<br />
Ette kürzlich festgestellt hat, ist Humboldts Ansatz<br />
<strong>Die</strong> Gartenlaube, September 1869. Privatsammlung München.<br />
nicht interdisziplinär, sondern vielmehr trans -<br />
disziplinär: Humboldt sucht den Dialog mit<br />
anderen Disziplinen nicht vom Standpunkt einer<br />
einzigen, eigenen Disziplin aus, sondern er<br />
verbindet <strong>die</strong> unterschiedlichsten Bereiche der<br />
Wissenschaft mit einander. Man könnte sein<br />
Konzept deshalb auch als transdisziplinäre Welt -<br />
wissenschaft beschreiben. Im Untertitel seines<br />
„Kosmos“ be zeichnet Humboldt selbst seine<br />
Konzeption als „Physische Weltbeschreibung“.<br />
In Humboldts Wissenschaftskonzeption<br />
nimmt das Klima eine zentrale Stellung ein. <strong>Die</strong><br />
Atmosphäre sah er als einen „Luft-Ocean“, auf<br />
dessen Grund <strong>die</strong> Menschen und alle anderen<br />
Landbewohner leben. Bereits 1831 lieferte Hum -<br />
boldt in seinen Fragmenten einer Geologie und<br />
Klimatologie Asiens, und später 1845, in seinem<br />
weitaus prominenteren Kosmos. Darin lieferte er<br />
1845 eine bis heute immer noch weitgehend<br />
akzeptierte Definition des Begriffs Klima: „Das<br />
Wort Klima bezeichnet [...] zuerst eine specifische<br />
Beschaffenheit des Luftkreises; aber <strong>die</strong>se Beschaf -<br />
fenheit ist abhängig von dem perpe tuir lichen<br />
Zusammenwirken einer all- und tiefbewegten,<br />
durch Strömungen von ganz entgegen gesetzter<br />
Temperatur durchfurchten Meeresfläche mit der<br />
wärmestrahlenden trockenen Erde: <strong>die</strong> mannig -<br />
faltig gegliedert, erhöht, gefärbt, nackt oder mit<br />
Wald und Kräutern bedeckt ist.”<br />
An anderer Stelle, ebenfalls in <strong>ersten</strong> Band des<br />
Kosmos, findet sich folgende Erklärung: „Der<br />
Ausdruck Klima bezeichnet in seinem allgemeins -<br />
ten Sinne alle Veränderungen in der Atmosphäre,<br />
<strong>die</strong> unsre Or gane merklich afficiren: <strong>die</strong> Tempera -<br />
Abschied vom Kosmos, Holzstich von Johann Carl Wilhelm Aarland<br />
nach einer Zeichnung von Wilhelm von Kaulbach<br />
21