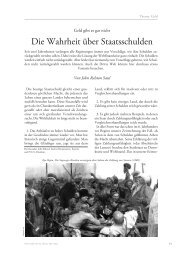die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
die vermeidbare katastrophe die ersten warnzeichen ... - Die Gazette
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schen Industrie, sondern auch aus weiterverarbeitenden<br />
Chemie-Branchen wie Zement-, Automobil-,<br />
Textil-, und Pharma-Industrie. <strong>Die</strong> Lobbytätigkeit<br />
der USA war ein historischer Höhepunkt an Einmischung<br />
in europäische Angelegenheiten. Robert<br />
Donkers, der von der EU-Kommission 2003 in <strong>die</strong><br />
USA entsandt wurde, um den Amerikanern REACH<br />
zu erläutern, schlug mir vor, ich solle mit das einmal<br />
umgekehrt vorstellen: Europäische Regierungsvertreter<br />
fliegen in Washington ein und machen Stimmung<br />
gegen ein Gesetz, das gerade im Kongress beraten<br />
wird. „Das würde nicht durchgehen“, sagte er,<br />
„nach zehn Minuten wären wir draußen!“<br />
Kampfblatt<br />
Der Sozialstaat als Misserfolgsgeschichte<br />
In ihrer Broschüre Initiative Kompakt. Das kleine<br />
1x1 der Sozialen Marktwirtschaft baut <strong>die</strong> sogenannte<br />
„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“<br />
(INSM) den Sozialstaat ab – mit falschen Zahlenspielen.<br />
Wo selbst <strong>die</strong> Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
2007 ein mittleres Netto-Einkommen von 59<br />
Prozent der Bruttosumme errechnet, behauptet <strong>die</strong><br />
INSM, von jedem Euro gehe mehr als <strong>die</strong> Hälfte an<br />
den Staat. Was liegt da näher, als <strong>die</strong> „erfolglose“<br />
Sozialhilfe abzuschaffen und <strong>die</strong> Bedürftigen sich<br />
selbst und dem Markt zu überlassen?<br />
Wir könnten uns zur Abwechslung einmal dazu<br />
durchringen, das Konzept der Marktwirtschaft auch<br />
wirklich umzusetzen – und nicht immer nur eine<br />
abgespeckte Variante davon. Mehr Marktwirtschaft,<br />
das hieße vor allem: weniger Staat. Doch<br />
warum eigentlich? Warum soll sich der Staat soweit<br />
es geht zurückziehen und dem Markt Platz machen?<br />
<strong>Die</strong> Antwort lautet: 5. Juli 2006, 5 Uhr 35. Das<br />
nämlich ist nach Berechnungen des Bundes der<br />
Steuerzahler exakt der Zeitpunkt, bis zu dem alle<br />
Deutschen ihr gesamtes Einkommen, das sie bis<br />
dahin in <strong>die</strong>sem Jahr erwirtschaftet haben, in Form<br />
von Steuern und Sozialabgaben an <strong>die</strong> Staatskassen<br />
abführen. Von den 365 Tagen des Jahres 2006 arbeiten<br />
wir also 186 Tage ausschließlich für den Staat –<br />
und nur 179 Tage fürs eigene Portemonnaie. Oder<br />
anders gerechnet: Von jedem einzelnen Euro Ver<strong>die</strong>nst<br />
geht mehr als <strong>die</strong> Hälfte an den Staat. Keine<br />
Frage, ohne Staat geht es auch nicht. Wir, <strong>die</strong> Gesellschaft,<br />
brauchen <strong>die</strong> Polizei, <strong>die</strong> Bundeswehr, Ämter<br />
und Behörden, <strong>die</strong> Justiz, Universitäten, Straßen<br />
und dergleichen mehr. Das alles kostet Geld. Was<br />
aber ist mit jenen Abermilliarden Euro, <strong>die</strong> der Staat<br />
und <strong>die</strong> Sozialkassen jedes Jahr von den Bundesbürgern<br />
und den Unternehmen einsammeln, nur um<br />
sie dann – im Namen der Gerechtigkeit – über Subventionen<br />
und Sozialleistungen wieder an <strong>die</strong> Bürger<br />
und Betriebe zurückzugeben? Ist <strong>die</strong>se Umverteilung,<br />
wie Ökonomen das Ganze nennen,<br />
überhaupt noch sinnvoll?<br />
Machen wir <strong>die</strong> Probe aufs Exempel: Das deutsche<br />
Sozialbudget hat sich seit 1960 von damals rund 33<br />
Milliarden Euro auf mittlerweile fast 696 Milliarden<br />
Euro erhöht. <strong>Die</strong>ses Geld fließt in <strong>die</strong> Renten-,<br />
Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung,<br />
es wird ausgegeben für Beamtenpensionen,<br />
Altershilfen für Landwirte, <strong>die</strong> Entgeltfortzahlung<br />
bei Krankheit, Kindergeld, Erziehungsgeld,<br />
soziale Entschädigungen, Wohngeld, Jugendhilfe<br />
und Sozialhilfe.<br />
Jahr für Jahr gibt Deutschland mehr und mehr<br />
Geld dafür aus, <strong>die</strong> Risiken des Lebens abzusichern<br />
und abzufedern. Mit Erfolg? Mitnichten! <strong>Die</strong> Rentenversicherungen<br />
hangeln sich von Monat zu<br />
Monat; <strong>die</strong> Pflegeversicherung ist ein finanzielles<br />
Desaster; das deutsche Gesundheitssystem verschlingt<br />
Milliarden, gilt aber nach internationalen<br />
Maßstäben als ineffizient; <strong>die</strong> Arbeitslosigkeit ist<br />
trotz ABM, Frühverrentung und all der anderen<br />
Programme gestiegen und gestiegen; und <strong>die</strong> Förderung<br />
der Familie über Kinder-und Erziehungsgeld<br />
hat alles Mögliche bewirkt – nur nicht den dringend<br />
benötigten Anstieg der Geburtenrate und der Frauenerwerbstätigkeit.<br />
Politik als Marken-Ware<br />
Man muss sie nur richtig verkaufen<br />
Eine Umfrage aus der Münchner Dissertation Politische<br />
Kommunikation. Analyse und Perspektiven<br />
eines sich verändernden Kommunikations-Genres<br />
von Hans Peter Ketterl, M.A. (Neuere Deutsche Literatur,<br />
Wintersemester 2003/2004) zu der Frage, wie<br />
man Politik richtig vermarktet::<br />
1. Wie beurteilen Sie <strong>die</strong> Möglichkeit, eine Partei<br />
wie eine Produkt-Marke zu führen?<br />
Olaf Scholz (SPD): Eine Partei unterliegt anderen<br />
Gesetzen als eine Produkt-Marke, ihre Führung<br />
erfolgt nach politischen Urteilen und Abwägungen.<br />
Kommunikative Überlegungen fließen in <strong>die</strong>se<br />
Abwägungen ein.<br />
Laurenz Meyer (CDU): Mit Blick auf ein zeitgemäßes<br />
Politikmarketing ist <strong>die</strong> Wiedererkennbarkeit<br />
der „Marke CDU“ natürlich von zentraler Be -<br />
deu tung. <strong>Die</strong> CDU hat 2002 ihre Corporate<br />
Identity behutsam modernisiert (Logo etc.). Alle<br />
Verbände haben ein „Markenhandbuch“ erhalten,<br />
um <strong>die</strong> Einheitlichkeit dezentral erstellter Kommunikationsmittel<br />
zu gewährleisten.<br />
Dr. Thomas Goppel (CSU): Mit einer Marke verbinden<br />
Konsumenten idealer Weise verschiedene<br />
Eigenschaften. <strong>Die</strong>s gilt selbstverständlich auch für<br />
den Wähler im Bezug zu einer Partei.<br />
Steffi Lemke (Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen): Eine Partei<br />
ist natürlich vielschichtiger und dynamischer als<br />
eine reine Produkt-Marke. Deshalb ist nur begrenzt<br />
möglich, eine Partei im klassischen als Marke zu<br />
betrachten. Allerdings sind klassische „Markeneigenschaften“<br />
wie Markenattraktivität, Abgrenzung<br />
zu anderen Marken, ein Logo und ein corporate<br />
design auch für Parteien notwendig.<br />
9