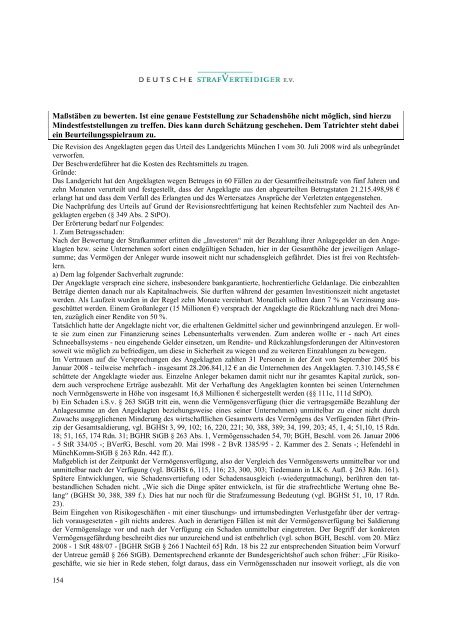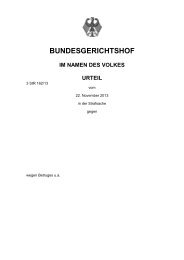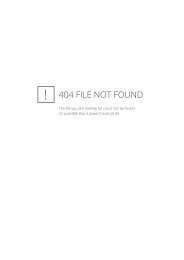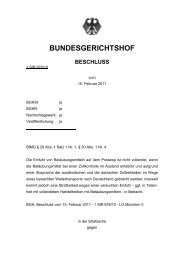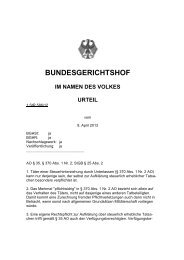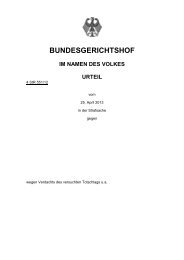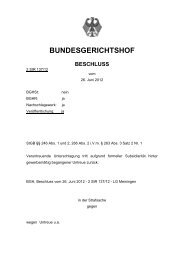- Seite 1 und 2:
Arbeitsunterlagen zum Sommerlehrgan
- Seite 3 und 4:
Materielles Strafrecht StGB StGB §
- Seite 5 und 6:
a) Bei den von der PBDE ausgeschrie
- Seite 7 und 8:
gentum steht (vgl. BGHSt 50, 299).
- Seite 9 und 10:
Gründe: Das Landgericht hat den An
- Seite 11 und 12:
i.V.m. Gebührennummern 451 ff. der
- Seite 13 und 14:
Das Landgericht ist - entgegen dem
- Seite 15 und 16:
In der letzten Zeit vor der Tat sch
- Seite 17 und 18:
Frühere Verhaltensweisen des Täte
- Seite 19 und 20:
Kenntnis bei der von ihm anzustifte
- Seite 21 und 22:
2. Im Umfang der Aufhebung wird die
- Seite 23 und 24:
werden. Dabei sind um so geringere
- Seite 25 und 26:
1:1,5 aus. Eine noch günstigere An
- Seite 27 und 28:
che rechtswidrige Taten begehen wir
- Seite 29 und 30:
seiner Taten einzusehen, (sei) durc
- Seite 31 und 32:
2. Am 23. November 1994 wurde der V
- Seite 33 und 34:
Strafvollzugs eingeholten psychiatr
- Seite 35 und 36:
2. Das Landgericht hat zwar die for
- Seite 37 und 38:
StGB § 066 IV 3, StGB § 66b I 2,
- Seite 39 und 40:
Verurteilung bereits bekannt waren.
- Seite 41 und 42:
StGB § 066b Grenzen nachträgliche
- Seite 43 und 44:
wollte, kommt darin doch zum Ausdru
- Seite 45 und 46:
ausgeführt, dass dem Angeklagten k
- Seite 47 und 48:
Unterbringung in einem psychiatrisc
- Seite 49 und 50:
Begrenzung entfiel erst zum 29. Jul
- Seite 51 und 52:
von knapp vier Monaten verbüßte d
- Seite 53 und 54:
gel in die Freiheit zu entlassen w
- Seite 55 und 56:
anderen Tatsachen herzuleiten ist a
- Seite 57 und 58:
seinem Rechtsträger nicht zu. Die
- Seite 59 und 60:
) Den Gründen des landgerichtliche
- Seite 61 und 62:
Ermessensentscheidung nach § 73 c
- Seite 63 und 64:
anordnung ist deshalb nur dann gem
- Seite 65 und 66:
1. Die Anordnung der ersten Beschul
- Seite 67 und 68:
4. Nach alledem hätte bereits das
- Seite 69 und 70:
selber Gegenstände geworfen“ ode
- Seite 71 und 72:
Die von dem Angeschuldigten erworbe
- Seite 73 und 74:
(nackten) Körpers durch Sperma des
- Seite 75 und 76:
Revision, mit der er die Verletzung
- Seite 77 und 78:
Die Strafkammer hat sich eingehend
- Seite 79 und 80:
Das Landgericht hat den Angeklagten
- Seite 81 und 82:
sich gut merken und gut zuordnen ka
- Seite 83 und 84:
Komm-StGB § 184 b Rdn. 35). Diese
- Seite 85 und 86:
Das Rechtsmittel hat zum Schuldspru
- Seite 87 und 88:
nisverweigerungsrecht im Verfahren
- Seite 89 und 90:
sichergestellt, da es sich um eine
- Seite 91 und 92:
P. in seinem Tatentschluss bestärk
- Seite 93 und 94:
Der Senat schließt aus, dass sich
- Seite 95 und 96:
StGB § 211 II niedrige Beweggründ
- Seite 97 und 98:
eiten" und sich "gegenseitig zuguck
- Seite 99 und 100:
Nach den Feststellungen des Landger
- Seite 101 und 102:
Durchgreifenden Bedenken begegnet a
- Seite 103 und 104: des Kindes wochenlang das Obergesch
- Seite 105 und 106: a) Die Strafkammer geht mit eingehe
- Seite 107 und 108: 5. Ein Beruhen des Urteils auf der
- Seite 109 und 110: Die vom Geschädigten erlittenen Ve
- Seite 111 und 112: Kokaingemisch erhalten oder er hatt
- Seite 113 und 114: II. Im Umfang der Aufhebung wird di
- Seite 115 und 116: f) Die insbesondere von Teilen des
- Seite 117 und 118: IV. Erfolglos ist auch das Rechtsmi
- Seite 119 und 120: gerade nicht in den Aufgabenbereich
- Seite 121 und 122: StGB § 223, WStG § 30 I, WStG §
- Seite 123 und 124: tigten, die Rekruten nach der diens
- Seite 125 und 126: solchen Waffen verursachen können,
- Seite 127 und 128: Für die Kammer ließ sich in der B
- Seite 129 und 130: eigenen Einlassung beteiligt war“
- Seite 131 und 132: c) Dies hat das Landgericht nicht i
- Seite 133 und 134: der soldatischen Gemeinschaft Anspr
- Seite 135 und 136: Durchführung der Tat sowie der Umf
- Seite 137 und 138: a) Der Angeklagte stellte dem ehema
- Seite 139 und 140: uch und deshalb zu einem erhöhten
- Seite 141 und 142: trächtigung des Stammkapitals entg
- Seite 143 und 144: Wirkungen der ohne Wegnahmeabsicht
- Seite 145 und 146: den erwachsenen Angeklagten R. - un
- Seite 147 und 148: StGB § 250 I Nr. 1b Raub mit Hilfe
- Seite 149 und 150: pistole, was die Geschädigten jedo
- Seite 151 und 152: 2. Bei der Beurteilung, ob der Tät
- Seite 153: StGB § 261, StPO § 24, StPO § 26
- Seite 157 und 158: Ausführungen hierzu hätten die Gr
- Seite 159 und 160: ohne Schwierigkeiten, namentlich oh
- Seite 161 und 162: II. Die Revision des Angeklagten is
- Seite 163 und 164: § 263 Rdn. 176 f.). Diese Vorausse
- Seite 165 und 166: 3. Der Generalbundesanwalt hat bean
- Seite 167 und 168: 1. im Fall II.1 der Urteilsgründe
- Seite 169 und 170: Produzione S.p.A. einen Auftrag zum
- Seite 171 und 172: lungen anfechtbar und daher in sein
- Seite 173 und 174: dann, wenn dieser Vorteil nur durch
- Seite 175 und 176: d) Der Auffassung des Senats steht
- Seite 177 und 178: träger eines anderen Mitgliedstaat
- Seite 179 und 180: diente die Überweisung lediglich p
- Seite 181 und 182: Das Rechtsmittel hat in dem aus der
- Seite 183 und 184: Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 StPO vo
- Seite 185 und 186: oder halten; bei der Tathandlung de
- Seite 187 und 188: 3. Der Senat hat - entsprechend dem
- Seite 189 und 190: 3. Der nur geringfügige Erfolg der
- Seite 191 und 192: Am 20. Dezember 2005 unterzeichnete
- Seite 193 und 194: die nur auszugsweise wiedergegebene
- Seite 195 und 196: Amtsträger zu verstehen sind. Dage
- Seite 197 und 198: lichen Gehalt. Dient der Täter in
- Seite 199 und 200: Der Beschwerdeführer hat die Koste
- Seite 201 und 202: einem solchen Fall nachträglich Ke
- Seite 203 und 204: Umsatzsteuervoranmeldungen gemäß
- Seite 205 und 206:
satzsteuerjahreserklärungen für d
- Seite 207 und 208:
404/08), hat bereits der Große Sen
- Seite 209 und 210:
zeichnungen veräußerte (UA S. 3,
- Seite 211 und 212:
gung im Sinne der Vorschrift des §
- Seite 213 und 214:
Schon die bis Ende des Jahres 2007
- Seite 215 und 216:
kann das „große Ausmaß“ höhe
- Seite 217 und 218:
AO § 370 Abs. 1 und 4, UStG § 18,
- Seite 219 und 220:
) Dies hält rechtlicher Nachprüfu
- Seite 221 und 222:
eits wegen Verletzung seiner Pflich
- Seite 223 und 224:
Situation besteht, wenn - was eher
- Seite 225 und 226:
Rechnungen erlangen, die ihr ermög
- Seite 227 und 228:
steuer ausgerichtete Lieferkette. N
- Seite 229 und 230:
nen Steuern abgestellt wird, nach
- Seite 231 und 232:
c) Das im Gemeinschaftsrecht verank
- Seite 233 und 234:
AufenthG § 95 Abs. 1 Nr. 7, § 61
- Seite 235 und 236:
waltshandbuch Strafverteidigung S.
- Seite 237 und 238:
2. Holen die Strafverfolgungsorgane
- Seite 239 und 240:
verbinden, gerade auch auf dem Gebi
- Seite 241 und 242:
) Durch das Verbringen der Teillief
- Seite 243 und 244:
gewerbsmäßiger Begehung einer ans
- Seite 245 und 246:
Nach den Feststellungen des Landger
- Seite 247 und 248:
Das Landgericht hat den Angeklagten
- Seite 249 und 250:
zur Befriedigung des Schlafbedarfs
- Seite 251 und 252:
Dadurch entfällt zwar die vom Land
- Seite 253 und 254:
1. Die Verurteilung im Fall II. 1.
- Seite 255 und 256:
antenkreditbetrugs (BGHR StGB § 26
- Seite 257 und 258:
estimmt sein. Dies wäre bei einem
- Seite 259 und 260:
Die Insolvenzverschleppung ist hing
- Seite 261 und 262:
aa) Die neue Anklage ist nicht gem
- Seite 263 und 264:
mendes Territorium" des Flaggenstaa
- Seite 265 und 266:
nicht dahin ausgeweitet werden, das
- Seite 267 und 268:
sie wegen verbleibender Zweifel nic
- Seite 269 und 270:
cher, der ebenfalls am Senatsurteil
- Seite 271 und 272:
d) Die Befangenheitsanträge sind n
- Seite 273 und 274:
Zwar ist in Fällen, in denen das G
- Seite 275 und 276:
Die dem Senat damit eröffnete Prü
- Seite 277 und 278:
Rechtsprechung erlischt dieses Zeug
- Seite 279 und 280:
StPO § 059 I 1, StPO § 60 Zeugene
- Seite 281 und 282:
StPO § 100f, MRK Art. 6 Abs. 1 Sat
- Seite 283 und 284:
zwei russische Auftragsmörder enga
- Seite 285 und 286:
Der Angeklagte gab im Verlauf des
- Seite 287 und 288:
Zwar ist die Anwendung einer krimin
- Seite 289 und 290:
2006 angeordnet worden, nachdem fes
- Seite 291 und 292:
und Weise ihres Vollzuges umgedeute
- Seite 293 und 294:
- die Arrestbeschlüsse des Ermittl
- Seite 295 und 296:
StPO § 136 Abs. 1 Satz 2 Belehrung
- Seite 297 und 298:
So verhält es sich hier hinsichtli
- Seite 299 und 300:
Das Landgericht hat die Angeklagte
- Seite 301 und 302:
StPO § 141, § 143, § 413 Mindest
- Seite 303 und 304:
StPO § 147 Keine Akteneinsicht in
- Seite 305 und 306:
Der Senat muss nicht entscheiden, o
- Seite 307 und 308:
(3) Auch mit dem Argument der Gefah
- Seite 309 und 310:
zum Beispiel dann der Fall, wenn de
- Seite 311 und 312:
G r ü n d e Das Landgericht hat de
- Seite 313 und 314:
Danach hätte das Gericht ohne ausd
- Seite 315 und 316:
Das Landgericht hat die Diamantenge
- Seite 317 und 318:
Der Beschwerdeführer hat die Koste
- Seite 319 und 320:
che fehle. Nach dem Zusammenhang de
- Seite 321 und 322:
4. Wurde der Hinweispflicht entspro
- Seite 323 und 324:
(1) In der Regel kann ein Hilfsbewe
- Seite 325 und 326:
Der auf die Verletzung formellen un
- Seite 327 und 328:
nur zum vollständigen Tatsachenvor
- Seite 329 und 330:
2. Die Sache wird zu neuer Verhandl
- Seite 331 und 332:
StPO § 261 „Tatmotiv fehlt nicht
- Seite 333 und 334:
November 2006 - 2 BvR 1378/06; BGH
- Seite 335 und 336:
Gründe Das Landgericht hat den Ang
- Seite 337 und 338:
der Vorlage von Einzellichtbildern
- Seite 339 und 340:
StPO § 261 Darstellung im Urteil z
- Seite 341 und 342:
Ein solcher Grund kann nicht in dem
- Seite 343 und 344:
führt es aus, die Geschädigte hab
- Seite 345 und 346:
Größe des Pro-bandenkreises, die
- Seite 347 und 348:
Umstände (vgl. BGH NStZ-RR 2002, 3
- Seite 349 und 350:
jedenfalls aber so lange auf das Ko
- Seite 351 und 352:
2. Die Erhöhung einer Einzelstrafe
- Seite 353 und 354:
einen Vertrauenstatbestand geschaff
- Seite 355 und 356:
a) Die Strafkammer hat sich hinsich
- Seite 357 und 358:
Y. bedrohte mit der ungeladenen Gas
- Seite 359 und 360:
wird“. Welche der festgestellten
- Seite 361 und 362:
Auf die Revision des Angeklagten wi
- Seite 363 und 364:
StPO § 264 Körperverletzungen geg
- Seite 365 und 366:
Das Landgericht hat den Angeklagten
- Seite 367 und 368:
Milderungsgründe möglich ist (Fis
- Seite 369 und 370:
standet, weil sie den Einzelfall ni
- Seite 371 und 372:
) Bei einer - wie hier - Vielzahl a
- Seite 373 und 374:
Das Oberlandesgericht Frankfurt am
- Seite 375 und 376:
stößen ist gegebenenfalls nach al
- Seite 377 und 378:
StPO § 302 I 1 Rechtsmittelverzich
- Seite 379 und 380:
gung des Angeklagten in der Sicheru
- Seite 381 und 382:
aa) Die Entscheidung über die Anza
- Seite 383 und 384:
sung an die Schwurgerichtskammer is
- Seite 385 und 386:
der Straf-richter sei zur Vorlage b
- Seite 387 und 388:
StPO § 338 Nr. 5, StPO § 344 II 2
- Seite 389 und 390:
2. Die Nichtanwendung der Vollstrec
- Seite 391 und 392:
Beschlussverfahrens. Für grundlege
- Seite 393 und 394:
mit einer Anhörungsrüge gegen die
- Seite 395 und 396:
„Der Präsidialrat des Bundesverf
- Seite 397 und 398:
) soweit bezüglich des Angeklagten
- Seite 399 und 400:
StPO § 395 II Nr. 1 Leiche als Neb
- Seite 401 und 402:
StPO § 456a, GVG § 132 II Anfrage
- Seite 403 und 404:
nisses nach § 456 a StPO für die
- Seite 405 und 406:
Das Amtsgericht Göttingen hat am 1
- Seite 407 und 408:
StrEG§ 5 Abs. 2 S. 1 Unsorgfältig
- Seite 409 und 410:
desanwalts vom 6. Februar 2009, die
- Seite 411 und 412:
Das Landgericht hat die - im Übrig
- Seite 413 und 414:
Berücksichtigung der persönlichen
- Seite 415 und 416:
a) Der Senat braucht nicht zu entsc
- Seite 417 und 418:
In der Hauptverhandlung vom 26. Feb
- Seite 419 und 420:
Bereich rechtlicher Einzel-normieru
- Seite 421 und 422:
seine Erhebung kein Anlass bestand.
- Seite 423 und 424:
hätte ein ande-rer Richter den Vor
- Seite 425 und 426:
dem Datum des 26. August 2007 mit W
- Seite 427 und 428:
Auch die Sachrüge bleibt aus den G
- Seite 429 und 430:
Die Staatsanwaltschaft wendet sich
- Seite 431 und 432:
) Die formellen Voraussetzungen fü
- Seite 433 und 434:
Inhalt kann in hinreichender Weise
- Seite 435 und 436:
MRK Art. 6 III a Beschleunigungsgeb
- Seite 437 und 438:
BGH, Urt. v.04.09.2008 - 5 StR 101/
- Seite 439 und 440:
StGB § 246 II Unterschlagung noch
- Seite 441 und 442:
BtMG § 29a I Nr. 2 Auffangtatbesta
- Seite 443 und 444:
Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre
- Seite 445 und 446:
StPO § 344 II 2, EMRK Art 6 I 1 R