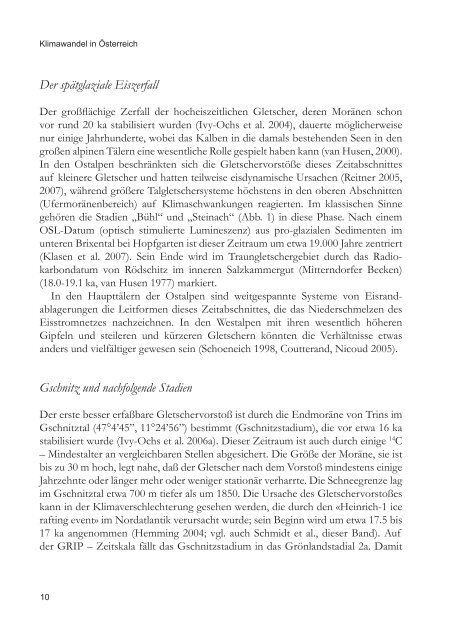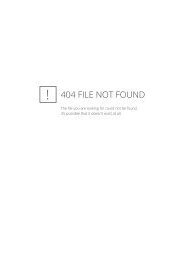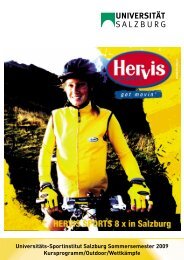Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>wandel in Österreich<br />
Der spätglaziale Eiszerfall<br />
Der großflächige Zerfall der hocheiszeitlichen Gletscher, deren Moränen schon<br />
vor rund 20 ka stabilisiert wurden (Ivy-Ochs et al. 2004), dauerte möglicherweise<br />
nur einige Jahrhunderte, wobei das Kalben in die damals bestehenden Seen in den<br />
großen alpinen Tälern eine wesentliche Rolle gespielt haben kann (van Husen, 2000).<br />
In den Ostalpen beschränkten sich die Gletschervorstöße dieses Zeitabschnittes<br />
auf kleinere Gletscher und hatten teilweise eisdynamische Ursachen (Reitner 2005,<br />
2007), während größere Talgletschersysteme höchstens in den oberen Abschnitten<br />
(Ufermoränenbereich) auf <strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>schwankungen reagierten. Im klassischen Sinne<br />
gehören die Stadien „Bühl“ und „Steinach“ (Abb. 1) in diese Phase. Nach einem<br />
OSL-Datum (optisch st<strong>im</strong>ulierte Lumineszenz) aus pro-glazialen Sed<strong>im</strong>enten <strong>im</strong><br />
unteren Brixental bei Hopfgarten ist dieser Zeitraum um etwa 19.000 Jahre zentriert<br />
(Klasen et al. 2007). Sein Ende wird <strong>im</strong> Traungletschergebiet durch das Radiokarbondatum<br />
von Rödschitz <strong>im</strong> inneren Salzkammergut (Mitterndorfer Becken)<br />
(18.0‐19.1 ka, van Husen 1977) markiert.<br />
In den Haupttälern der Ostalpen sind weitgespannte Systeme von Eisrandablagerungen<br />
die Leitformen dieses Zeitabschnittes, die das Niederschmelzen des<br />
Eisstromnetzes nachzeichnen. In den Westalpen mit ihren wesentlich höheren<br />
Gipfeln und steileren und kürzeren Gletschern könnten die Verhältnisse etwas<br />
anders und vielfältiger gewesen sein (Schoeneich 1998, Coutterand, Nicoud 2005).<br />
Gschnitz und nachfolgende Stadien<br />
Der erste besser erfaßbare Gletschervorstoß ist durch die Endmoräne von Trins <strong>im</strong><br />
Gschnitztal (47°4’45”, 11°24’56”) best<strong>im</strong>mt (Gschnitzstadium), die vor etwa 16 ka<br />
stabilisiert wurde (Ivy-Ochs et al. 2006a). Dieser Zeitraum ist auch durch einige 14 C<br />
– Mindestalter an vergleichbaren Stellen abgesichert. Die Größe der Moräne, sie ist<br />
bis zu 30 m hoch, legt nahe, daß der Gletscher nach dem Vorstoß mindestens einige<br />
Jahrzehnte oder länger mehr oder weniger stationär verharrte. Die Schneegrenze lag<br />
<strong>im</strong> Gschnitztal etwa 700 m tiefer als um 1850. Die Ursache des Gletschervorstoßes<br />
kann in der <strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>verschlechterung gesehen werden, die durch den «Heinrich-1 ice<br />
rafting event» <strong>im</strong> Nordatlantik verursacht wurde; sein Beginn wird um etwa 17.5 bis<br />
17 ka angenommen (Hemming 2004; vgl. auch Schmidt et al., dieser Band). Auf<br />
der GRIP – Zeitskala fällt das Gschnitzstadium in das Grönlandstadial 2a. Damit<br />
10