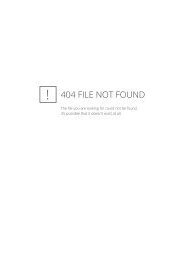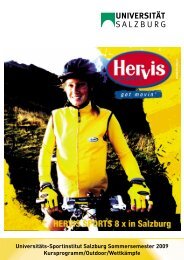Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>wandel in Österreich<br />
Für alle kl<strong>im</strong>ageschichtlichen Überlegungen ist es gerade in einer Zeit mit<br />
wechselnden kl<strong>im</strong>atischen Verhältnissen wichtig, einen Bezugsrahmen („heute“) zu<br />
definieren. Hier wird die kl<strong>im</strong>atische Normalperiode (-> von der WMO definierte 30<br />
jährige Zeiträume) 1931-60 verwendet, einerseits, weil sie den kl<strong>im</strong>atischen Hintergrund<br />
für die Gletscherinventare der späten Sechziger- und Siebzigerjahre liefert,<br />
und andererseits, weil sie für das gesamte 20. Jahrhundert typisch ist.<br />
Wenn nun die Änderung der Sommertemperatur aus anderen, möglichst gut<br />
synchronisierten Proxydaten (z.B. Waldgrenzschwankungen oder paläol<strong>im</strong>nologische<br />
Daten: vgl. z.B. Ammann et al. 2000, Magny et al. 2007) bekannt ist, kann mit<br />
einem der angeführten Verfahren aus der Schneegrenzdepression die Änderung des<br />
Niederschlags abgeleitet werden. Dabei sind die Waldgrenzschwankungen besonders<br />
interessant, da die Waldgrenze ein guter Indikator für die Sommertemperatur auf<br />
der selben Zeitskala wie die Ablationsperiode der Gletscher ist (Körner 2007).<br />
Änderungen des Temperaturfeldes sind zumindest in einem derart kleinen Gebiet<br />
wie den Alpen räumlich etwa konstant. Für einen gegebenen Zeitraum muß daher<br />
bei einer sehr starken Schneegrenzdepression mehr Niederschlag zur Verfügung<br />
gestanden haben, bei einer geringen weniger.<br />
Die einfache Handhabung, in der Praxis erfolgt die Berechnung mit EXCEL‐<br />
Tabellen, erlaubt es, verschiedene Szenarien zu berechnen und damit Bandbreiten<br />
für die möglichen Änderungen abzuschätzen (z.B. Kerschner und Ivy-Ochs 2007).<br />
Wegen der großen Stichprobe ist es auf diese Weise möglich, für die Zeit des<br />
Egesen-Max<strong>im</strong>alstandes (erste Hälfte der Jüngeren Dryas) die Ergebnisse auch in<br />
Kartenform darzustellen (Kerschner et al. 2000; Abb. 3) und regelmäßig nachzuführen.<br />
Die Verläßlichkeit derartiger Karten ist <strong>im</strong> einzelnen schwierig abzuschätzen;<br />
der Vergleich von Szenarien zeigt aber, daß die prinzipiellen Strukturen auch bei<br />
veränderten Annahmen erhalten bleiben. Dazu gehört in erster Linie eine verstärkte<br />
Trockenheit in den gut abgeschirmten Tälern der inneren Alpen und ein feuchter<br />
Alpennordsaum. In den Ötztaler Alpen und <strong>im</strong> oberen Inngebiet war der Niederschlag<br />
etwa 20 - 30% geringer als heute, während er am Alpennordsaum ungefähr<br />
gleich wie heute war. Diese Werte gelten für eine Sommertemperaturdepression von<br />
3.5 Grad. Verschiedene weitere Überlegungen (Kerschner, Ivy-Ochs 2007) zeigen,<br />
daß die Sommertemperaturdepression in der ersten Hälfte der Jüngeren Dryas nicht<br />
über 5 Grad hinausgegangen sein kann. In diesem Fall hätten die trockenen Gebiete<br />
nur mehr die Hälfte des heutigen Niederschlags bekommen, und auch der Alpennordsaum<br />
wäre etwas trockener als heute gewesen. Damit ergibt sich für den ersten<br />
Abschnitt der Jüngeren Dryas jedenfalls ein stärkerer Niederschlagsgradient vom<br />
16