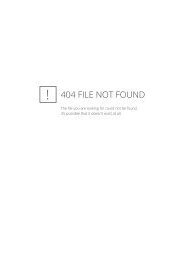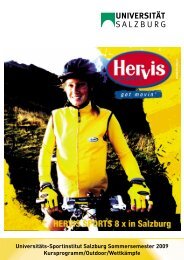Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Klima im Wandel Climate Change - Universität Salzburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>wandel in Österreich<br />
steht damit <strong>im</strong> Einklang. Eine kühlere und feuchtere Phase zwischen ca. 750 und<br />
350 BC trennt wiederum die Landnutzungsphase der Hallstatt von jener der Kelten<br />
bis zur Römerzeit. Höhere Seespiegelstände in Seen der nordwestlichen Alpen (u.a.<br />
Magny 2004) und Einbrüche in den Sauerstoff-Isotopen-Kurven (δ 18 O) Grönländischer<br />
Eiskerne (z.B. GRIP, Dansgaard et al. 1993; Grootes et al. 1993; Vergleich<br />
verschiedener Eiskerne: Vinther et al. 2006) zeigen die überregionale D<strong>im</strong>ension<br />
dieser beiden für ObLAN nachgewiesenen Kaltphasen. Die Keltenzeit könnte,<br />
nach der Temperaturableitung <strong>im</strong> oberen Landschitzsee zu schließen, durch stärkere<br />
saisonale Unterschiede zwischen wärmeren Herbsten und kühleren (schneereichen?)<br />
Frühlingen (siehe Little Ice Age, LIA), sowie eine allgemeine Abkühlung vor der<br />
Zeitenwende charakterisiert sein, was auch die niedrige Baumgrenze in dieser Zeit<br />
(Nicolussi et al. 2005) erklären würde.<br />
Eine Intensivierung (siehe Anteil anthropogener Pollenzeiger in Abb. 1), aufbauend<br />
auf der Tradition der Kelten, erfuhr die Almwirtschaft während der Römerzeit. Dafür<br />
dürften zwei Voraussetzungen maßgeblich gewesen sein: (1) die Römerzeit zeigt in<br />
der <strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>rekonstruktion von ObLAN ähnliche Temperaturen wie heute, was die<br />
Hochlagenbeweidung begünstigte; (2) entlang der Mur führte eine wichtige Nord-<br />
Süd-Verbindung der Römer. Straßensiedlungen <strong>im</strong> Lungau (z.B. Immurium, das<br />
heutige Moosham, Fleischer & Moucka-Weitzel 1998) dürften wahrscheinlich auch<br />
den Güteraustausch mit den umliegenden Almen gefördert haben. Diese Landnutzungsperiode<br />
endet mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches zwischen 476<br />
und 488 AD und der Völkerwanderung. Sowohl kl<strong>im</strong>atisch (feuchterer Abschnitt)<br />
als auch siedlungsgeschichtlich handelt es sich um eine Periode der Instabilität.<br />
Im Mittelalter beginnt die jüngste Welle der Weidewirtschaft an den Landschitzseen,<br />
die zwischen ca. 1.000 bis 1.400 AD (Hochmittelalter) gipfelte. Änderungen in<br />
der Zusammensetzung des Pollenspektrums von ObLAN lassen auf Rinderweiden<br />
schließen. Im Vergleich mit der römerzeitlichen Almweide (Schafe, Ziegen?) sind<br />
Nachweise von Pflanzenarten stickstoffliebender (nitrophiler) Lägergesellschaften,<br />
von Hochstauden, sowie Heide- (Besenheide), Wiesenpflanzen und Farne (Adlerfarn)<br />
häufig. Mit Ausnahme des Spätmittelalters während der sogenannten Kleinen<br />
Eiszeit handelte es sich um eine Reihe warmer Perioden, vor allem <strong>im</strong> Zeitraum<br />
1.000 bis 1.400 AD, die auch als Mittelalterliche Wärmeperiode (MWP) zusammengefasst<br />
werden. Die <strong>Kl<strong>im</strong>a</strong>rekonstruktion von ObLAN zeigt jedoch schon zwischen<br />
ca. 700 und 1.000 AD ein ähnliches, mit heutigen Temperaturen vergleichbares,<br />
Niveau, das durch kurzfristige kühle und feuchtere Phasen unterbrochen wurde<br />
(Nicolussi & Patzelt 2000, Nicolussi et al. 2005). Eine solche führte um ca. 1.100 AD<br />
92