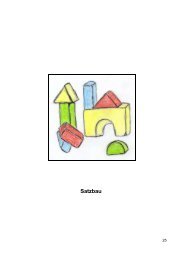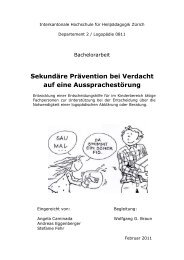SpraWISSImo - HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik ...
SpraWISSImo - HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik ...
SpraWISSImo - HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bachelorthese <strong>SpraWISSImo</strong> J.S. Wieland/C.Hanser<br />
Im Unterschied zur Prävention, welche von einem pathogenetischen Wirkungsprinzip<br />
ausgeht, geht die Gesundheitsförderung von einem salutogenetischen Wirkungsprinzip<br />
aus. Das pathogenetische Wirkungsprinzip basiert auf der Idee, Risikofaktoren<br />
zurückzudrängen oder auszuschalten, um eine Krankheit oder die Verschlechterung<br />
einer Krankheit vermeiden zu können. Das salutogenetische Wirkungsprinzip<br />
hingegen zielt darauf ab, Schutzfaktoren und Ressourcen zu stärken, um die Gesundheitsentwicklung<br />
zu verbessern. Ziel dieser Interventionsform ist es also, den<br />
gesunden Zustand eines Menschen zu stärken und ein höheres Niveau der Gesundheitsqualität<br />
zu erreichen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 13). „Dementsprechend<br />
richtet die Prävention ihr Argument vor allem auf Risikofaktoren <strong>für</strong> Krankheiten, die<br />
Gesundheitsförderung vor allem auf gesunderhaltende Schutzfaktoren“ (Hurrelmann<br />
et al., 2007, S. 14). Hurrelmann (2007) weist darauf hin, dass eine klare Abgrenzung<br />
dieser beiden Interventionsformen nicht möglich ist und dass sie als sich ergänzend<br />
zu verstehen sind (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 14). Die Ressourcen, welche gestärkt<br />
werden können, werden als personale, soziale und materielle Ressourcen<br />
unterschieden. Bei den personalen Ressourcen geht es um die physische Konstitution<br />
und die genetischen Voraussetzungen, aber auch um die emotionale und psychische<br />
Stabilität sowie die Persönlichkeitsbildung. Bei den sozialen Ressourcen<br />
geht es um die Qualität der sozialen Beziehungen und sozialen Netzwerke, während<br />
es bei den materiellen Ressourcen um privates Vermögen und finanzielle Sicherheit<br />
geht (vgl. Rosenbrock, Michel, 2007, S. 9-11).<br />
Hurrelmann et al. (2007) teilen die Schutzfaktoren noch genauer in fünf Kategorien<br />
ein.<br />
Tabelle 3: Die Kategorisierung der Schutzfaktoren nach Hurrelmann et al. (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 13-14)<br />
Soziale und wirtschaftliche Faktoren Arbeitsbedingungen, sozioökonomischer Status<br />
Umweltfaktoren Wohnbedingungen, soziale Kontakte<br />
Faktoren des Lebensstils Bewegung, Ernährung<br />
Psychologische Faktoren<br />
Zugang zu gesundheitsrelevanten<br />
Leistungen<br />
Kontrollüberzeugung, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung<br />
Zugang zu medizinischen Institutionen, aber auch zu<br />
Bildungs- und Sozialeinrichtungen<br />
29