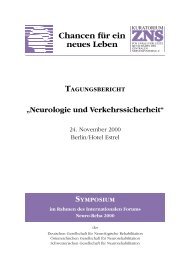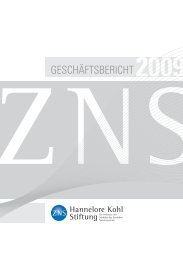Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Das</strong> kindliche SHT: Schädigungsursachen, Risikogruppen, Schweregrad...<br />
<strong>Das</strong> kindliche Schädel-Hirn-Trauma: Schädigungsursachen,<br />
Risikogruppen, Schweregrad, sowie Alter und<br />
Rehabilitationsergebnis<br />
Rainer Blank<br />
Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin,<br />
<strong>Kind</strong>erzentrum München<br />
Einleitung und Epidemiologie<br />
Ca. zwei Drittel aller Todesfälle im <strong>Kind</strong>esalter sind unfallverursacht. Hierbei<br />
beträgt die Hirnbeteiligung in Relation zu anderen Organen etwa 55:45. <strong>Das</strong><br />
jährliche Risiko beträgt bei Jungen ca. 1%, bei Mädchen ca. 0,5%. Allerdings<br />
muß erwähnt bleiben, daß in den letzten 15–20 Jahren nach verschiedenen<br />
Studien aus westlichen Ländern die Mortalität bei Jungen etwa halbiert werden<br />
konnte und bei Mädchen ca. 25% abgenommen hat (Engberg and Teasdale<br />
1998). Allerdings hat der Schweregrad der Verletzungen eher zugenommen<br />
und es wird diskutiert, daß die Gesamtprognose insgesamt unverändert<br />
geblieben sei.<br />
Die Lebenserwartung Schädel-Hirn-Verletzter ist nach einer neueren Studie<br />
prognostisch abhängig von der posttraumatischen Mobilität und dem Selbstversorgungsgrad,<br />
z.B. der Fähigkeit zu selbständigem Essen (Strauss et al. 1998).<br />
Mit erhaltener Mobilität kann man von einer Lebenserwartung die nur gering<br />
unter der der Allgemeinbevölkerung liegt, ausgehen. Bei Patienten ohne<br />
Mobilität wurde jedoch eine Lebenserwartung nur bis durchschnittlich rund<br />
15 Jahre nach dem Unfall ermittelt (Strauss et al. 1998).<br />
Der Anteil von <strong>Kind</strong>ern (im Alter von 1–15 Jahren) bei Schädelverletzungen<br />
kann nach Brookes (Brookes et al. 1990) folgendermaßen in etwa eingeschätzt<br />
werden: Die <strong>Kind</strong>er stellen einen Anteil von ca. der Hälfte aller Schädelhirnverletzungen,<br />
die in Unfall-Nothilfeabteilungen vorgestellt werden, sie stellen<br />
ca. 1/3 aller stationären Aufnahmen, ca. 1/4 aller Verletzungen schweren<br />
Grades und betragen rund 1/5 aller Todesfälle.<br />
Schädigungsursachen<br />
Im Gegensatz zum Erwachsenenalter stellen die Stürze den weitaus größten<br />
Anteil der Ursachen für Schädelverletzungen bei <strong>Kind</strong>ern dar, sie sind in etwa<br />
zu 60% verantwortlich. Die Verkehrsunfälle stellen nur einen Anteil von etwa<br />
10% dar; allerdings stellen diese den größten Anteil an schweren Verletzungen.<br />
So sind Schädel-Hirntraumen, die neurochirurgischer Behandlung bedürfen,<br />
bei etwa 43% anzutreffen. Ferner machen sie schwere Verletzungen<br />
sogar in 75% und Todesfälle in 71% aus (Jennett 1998).<br />
51