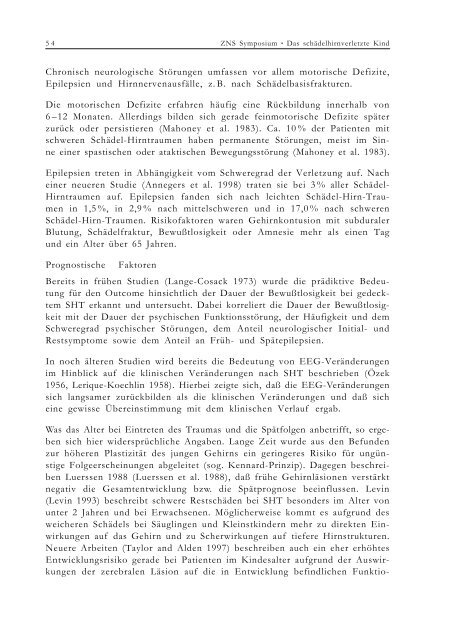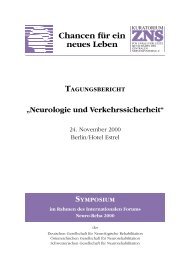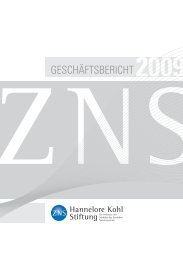Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
54<br />
Chronisch neurologische Störungen umfassen vor allem motorische Defizite,<br />
Epilepsien und Hirnnervenausfälle, z.B. nach Schädelbasisfrakturen.<br />
Die motorischen Defizite erfahren häufig eine Rückbildung innerhalb von<br />
6–12 Monaten. Allerdings bilden sich gerade feinmotorische Defizite später<br />
zurück oder persistieren (Mahoney et al. 1983). Ca. 10% der Patienten mit<br />
schweren Schädel-Hirntraumen haben permanente Störungen, meist im Sinne<br />
einer spastischen oder ataktischen Bewegungsstörung (Mahoney et al. 1983).<br />
Epilepsien treten in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verletzung auf. Nach<br />
einer neueren Studie (Annegers et al. 1998) traten sie bei 3% aller Schädel-<br />
Hirntraumen auf. Epilepsien fanden sich nach leichten Schädel-Hirn-Traumen<br />
in 1,5%, in 2,9% nach mittelschweren und in 17,0% nach schweren<br />
Schädel-Hirn-Traumen. Risikofaktoren waren Gehirnkontusion mit subduraler<br />
Blutung, Schädelfraktur, Bewußtlosigkeit oder Amnesie mehr als einen Tag<br />
und ein Alter über 65 Jahren.<br />
Prognostische Faktoren<br />
ZNS Symposium • <strong>Das</strong> <strong>schädelhirnverletzte</strong> <strong>Kind</strong><br />
Bereits in frühen Studien (Lange-Cosack 1973) wurde die prädiktive Bedeutung<br />
für den Outcome hinsichtlich der Dauer der Bewußtlosigkeit bei gedecktem<br />
SHT erkannt und untersucht. Dabei korreliert die Dauer der Bewußtlosigkeit<br />
mit der Dauer der psychischen Funktionsstörung, der Häufigkeit und dem<br />
Schweregrad psychischer Störungen, dem Anteil neurologischer Initial- und<br />
Restsymptome sowie dem Anteil an Früh- und Spätepilepsien.<br />
In noch älteren Studien wird bereits die Bedeutung von EEG-Veränderungen<br />
im Hinblick auf die klinischen Veränderungen nach SHT beschrieben (Özek<br />
1956, Lerique-Koechlin 1958). Hierbei zeigte sich, daß die EEG-Veränderungen<br />
sich langsamer zurückbilden als die klinischen Veränderungen und daß sich<br />
eine gewisse Übereinstimmung mit dem klinischen Verlauf ergab.<br />
Was das Alter bei Eintreten des Traumas und die Spätfolgen anbetrifft, so ergeben<br />
sich hier widersprüchliche Angaben. Lange Zeit wurde aus den Befunden<br />
zur höheren Plastizität des jungen Gehirns ein geringeres Risiko für ungünstige<br />
Folgeerscheinungen abgeleitet (sog. Kennard-Prinzip). Dagegen beschreiben<br />
Luerssen 1988 (Luerssen et al. 1988), daß frühe Gehirnläsionen verstärkt<br />
negativ die Gesamtentwicklung bzw. die Spätprognose beeinflussen. Levin<br />
(Levin 1993) beschreibt schwere Restschäden bei SHT besonders im Alter von<br />
unter 2 Jahren und bei Erwachsenen. Möglicherweise kommt es aufgrund des<br />
weicheren Schädels bei Säuglingen und Kleinstkindern mehr zu direkten Einwirkungen<br />
auf das Gehirn und zu Scherwirkungen auf tiefere Hirnstrukturen.<br />
Neuere Arbeiten (Taylor and Alden 1997) beschreiben auch ein eher erhöhtes<br />
Entwicklungsrisiko gerade bei Patienten im <strong>Kind</strong>esalter aufgrund der Auswirkungen<br />
der zerebralen Läsion auf die in Entwicklung befindlichen Funktio-