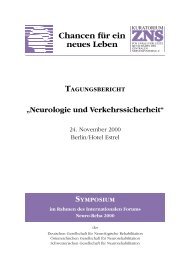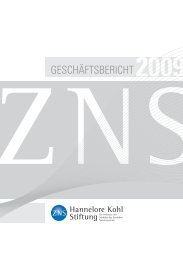Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Das</strong> kindliche SHT: Schädigungsursachen, Risikogruppen, Schweregrad...<br />
Als die wichtigsten Risikogruppen, die häufig zu Schädel-Hirn-Traumen neigten,<br />
beschrieben sie die <strong>Kind</strong>er mit mentaler Retardierung bzw. leichter<br />
prämorbider Intelligenzminderung, die <strong>Kind</strong>er mit früheren Unfällen mit Hirnbeteiligung,<br />
wobei sie auch <strong>Kind</strong>er mit früherer Commotio mitzählten. In<br />
dieser Gruppe überwogen massiv die Jungen (41 Jungen versus 5 Mädchen).<br />
Schließlich beschrieben sie schon die Risikogruppe der hyperaktiven <strong>Kind</strong>er,<br />
d.h. <strong>Kind</strong>er die bereits vor dem Unfall als sehr lebhaft, unruhig und impulsiv<br />
beschrieben worden waren. Diese Gruppe dürfte sich mit den beiden zuvor<br />
genannten Gruppen erheblich überlappen. Diese drei Gruppen waren in<br />
einer Häufigkeit von 10–20 % aller <strong>schädelhirnverletzte</strong>n <strong>Kind</strong>er jeweils<br />
anzutreffen. In einer neueren Studie (Gerring et al. 1998) wurde die Frage des<br />
prämorbid vorhandenen hyperkinetischen Syndroms wissenschaftlich näher<br />
untersucht. Man fand hierbei, daß bei ca. 20% aller schädel-hirn-traumatisierten<br />
<strong>Kind</strong>er bereits vor dem Unfall ein sog. hyperkinetisches Syndrom<br />
bzw. eine Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität vorgelegen hat.<br />
Als weitere Risikofaktoren für Unfälle kommen Störung der Wahrnehmung<br />
bzw. des Sehens sowie mangelhafte Verkehrserziehung und zu geringer Einsatz<br />
von Schutzvorrichtungen wie Helm oder Gurt in Frage (Linn et al. 1998).<br />
Mittel- und langfristige Unfallfolgen<br />
Es besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, daß die psychischen Langzeitfolgen<br />
eine größere Bedeutung als die neurologischen Folgen einnehmen.<br />
Bereits nach einer frühen Untersuchung (Kleinpeter 1971) nehmen die Verhaltensauffälligkeiten<br />
nach Schädel-Hirntraumata (SHT) einen sehr breiten Raum<br />
ein. Sie kommen danach bei SHT I nach Tönnes in ca. 60%, in SHT II in<br />
ca. 75% und bei <strong>Kind</strong>ern mit SHT III bei ca. 95% aller Fälle vor.<br />
Dabei werden posttraumatische Intelligenzminderungen (posttraumatische<br />
Demenz) in 8% bei Grad I, in 11% bei Grad II und in 39% bei Grad III<br />
Schädel-Hirntraumen berichtet.<br />
Gerring et al. (Gerring et al. 1998) berichten von sekundären hyperkinetischen<br />
Störungen bis einem Jahr nach dem SHT in ca. 20% aller Verunfallten. Diese<br />
<strong>Kind</strong>er fielen bereits prämorbid durch erhöhte psychosoziale Schwierigkeiten<br />
auf. Insgesamt war posttraumisch eine höhere Affektlabilität, Aggressivität und<br />
Komorbidität zu verzeichnen. Hinzu kommen hirnlokal bedingte Ausfälle wie<br />
Frontalhirnsyndrome, Aphasien und Apraxien, sowie psychoreaktive und<br />
neurotische Störungen im Rahmen der Traumaverarbeitung, welche sich in<br />
depressiven Anpassungsreaktionen, verstärkter Aggressivität, psychosomatischen<br />
Beschwerden, Konversionssymptomen und Angstzuständen zeigen.<br />
53