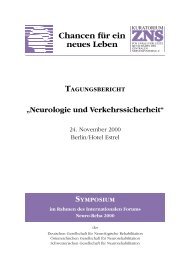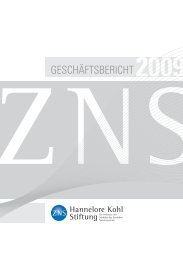Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Das schädelhirnverletzte Kind: Prävention ... - Hannelore Kohl Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Das</strong> kindliche SHT: Schädigungsursachen, Risikogruppen, Schweregrad...<br />
nen. Teilleistungsstörungen können sich selbst nach initial unauffälligem<br />
Befund als Folge im Verlauf der weiteren Entwicklung herausbilden. So fanden<br />
Gronwall (Gronwall et al. 1997) bei <strong>Kind</strong>ern nach leichtem SHT im<br />
Vorschulalter ungünstige Effekte auf die Leistungsfähigkeit nach einem Zeitintervall<br />
von 6 Monaten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Benz und Ritz<br />
berichten in einer noch nicht abgeschlossenen katamnestischen Studie ebenfalls<br />
von einer Heterogenität im Rückbildungsverlauf hinsichtlich der langfristigen<br />
kognitiven, sozialen und schulisch-beruflichen Entwicklung von Menschen<br />
nach kindlichen Schädel-Hirntraumen (Benz 1999). Dabei zeichnen sich<br />
bei einigen Patienten persistierende neuropsychologische Funktionsstörungen<br />
ab, weitere zeigen trotz initialer Befundstabilisierung im Verlauf posttraumatisch<br />
erworbene Defizite. Eine besonders ungünstige Gruppe zeigt ein<br />
globales Absinken der kognitiven und neuropsychologischen Leistungsfähigkeit.<br />
Bei einer vierten Gruppe kommt es zu einer fortschreitenden Stabilisierung<br />
der neuropsychologischen Parameter.<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Bei den SHT im <strong>Kind</strong>esalter sind die Stürze am häufigsten und die Unfälle im<br />
Straßenverkehr am schwersten. <strong>Kind</strong>er sind überproportional schwer betroffen,<br />
Jungen mehr als Mädchen. <strong>Kind</strong>er mit hyperkinetischem Syndrom und<br />
z.T. auch <strong>Kind</strong>er mit Entwicklungsstörungen machen hierbei eine große und<br />
wichtige Risikogruppe aus. Andererseits stellen hyperaktive Verhaltensweisen<br />
bzw. organische Wesensveränderungen und neuropsychologische Probleme<br />
auch häufige Sekundärfolgen nach SHT im <strong>Kind</strong>esalter dar. Hinsichtlich der<br />
neurologischen Störungsrückbildung bleibt zu vermerken, daß sich handmotorische<br />
Störungen schlechter rückbilden bzw. eher bestehen bleiben als<br />
Störungen der Grobmotorik.<br />
Präventive wie rehabilitative Konzepte müssen daher stärker als bisher <strong>Kind</strong>er<br />
mit psychosozialen Risikofaktoren und hier insbesondere mit hyperkinetischem<br />
Syndrom umfassen. Dabei sollte nicht nur die frühzeitige Diagnostik<br />
und Therapie des hyperkinetischen Syndroms, sondern auch die entsprechende<br />
Aufklärung von Eltern und pädagogischen Institutionen zu den<br />
Risiken dieser <strong>Kind</strong>er in höherem Maße stattfinden. Im Hinblick auf die schlechtere<br />
Rückbildung feinmotorischer Funktionen, welche im Alltag gerade bei<br />
der Selbstversorgung und schulischen bzw. beruflichen Wiedereingliederung<br />
eine erhebliche Rolle spielen, sind nicht nur spezifische und intensivere<br />
Behandlungsbemühungen, sondern auch genauere verlaufsdiagnostische<br />
Monitoringverfahren zur Differentialdiagnostik solcher Störungen und<br />
Verlaufsevaluation der Rehabilitationserfolge angezeigt.<br />
Hinsichtlich der zu erwartenden Rehabilitationsergebnisse sind epidemiologische<br />
Zahlen bei <strong>Kind</strong>ern von begrenzter Aussagefähigkeit, denn bei ähnlich<br />
55