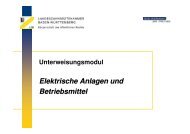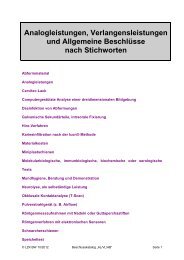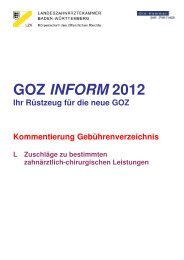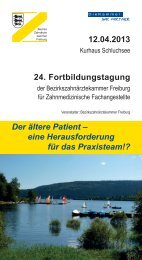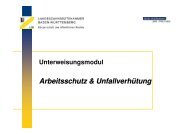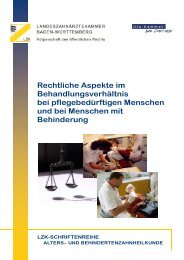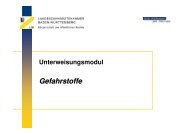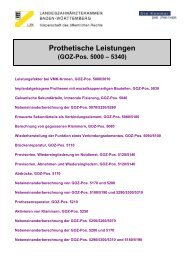Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
82 |<br />
und legitimen persönlichen Wünschen des Patienten im Einzelfall<br />
nicht entspricht, oder eine Leistung zu beschaffen, die<br />
gleichsam ein sozialstaatliches „ultra posse“ darstellt, weil sie<br />
in einer Disproportionalität zur jeweiligen finanziellen Leistungsfähigkeit<br />
der Krankenkasse steht.<br />
Gerade auch beim Zahnersatz mit seinen vielfältigen Wahlmöglichkeiten<br />
und Versorgungsformen musste der Gesetzgeber<br />
die unzulängliche Flexibilität öffentlich-rechtlicher Anspruchsnormierung<br />
anerkennen und die Möglichkeit eröffnen, dass<br />
der Versicherte nicht nur den Eigenanteil (§ 30 Abs. 2 SGB V),<br />
sondern für aufwändigere Versorgungsformen die Mehrkosten<br />
selbst zu tragen hat (§ 30 Abs. 3 SGB V). Das Gleiche gilt für<br />
Zahnfüllungen (§ 28 Abs. 2 S. 2 SGB V). Wie ausgeprägt das<br />
Beharrungspotential des Sachleistungsprinzips im deutschen<br />
Sozialversicherungsrecht ist, beweist die Neuregelung des<br />
Zahnersatzes im „Gesetz zur Modernisierung des Gesundheitssystems“<br />
(GMG) vom 1. Januar 2004, durch das befundorietierte<br />
Festzuschüsse zum Zahnersatz vorgesehen sind. Andererseits<br />
wird durch den Regelungsentwurf das starre Korsett<br />
der Sachleistung mit seiner Alles-oder-Nichts-Beschränkung<br />
gesprengt, weil der Versicherte, wenn er sich für aufwändigere<br />
gleich- oder andersartige Versorgungsformen entscheidet, den<br />
Festzuschuss in diese Versorgungsform „mitnimmt“.<br />
Der weitgehende Ausschluss der Privatautonomie im Sachleistungsprinzip,<br />
die Herauslösung konstituierender Gestaltungskomponenten<br />
des Vertragstypus, nämlich Leistung und Gegenleistung<br />
aus der Vertragsbeziehung zwischen Zahnarzt und<br />
Patient, zerreißt das duale Schuldverhältnis als synallagmatisches<br />
Regelungsgefüge und Gestaltungseinheit und wirft<br />
darüber hinaus bedeutsame Fragen des Selbstverständnisses<br />
(zahn-)ärztlicher Berufsausübung im System der Gesetzlichen<br />
Krankenversicherung auf: Der für privatrechtliche Vertragsverhältnisse<br />
charakteristische Konsens wird bereits auf öffentlichrechtlicher<br />
Ebene antizipiert, nämlich in den Beziehungen<br />
Versicherter/Krankenkassen einerseits und Krankenkasse/<br />
Kassen(zahn-)ärztliche Vereinigung/Kassenarzt andererseits.<br />
Die Sachleistungsgewährung und das Arzt-Patienten-Verhältnis<br />
werden damit gekennzeichnet von der Anonymität und<br />
Intransparenz der Leistungsbeziehung. Die öffentlich-rechtliche<br />
Präformierung des Behandlungsverhältnisses wird aber<br />
der Vertrauensbeziehung zwischen (Zahn-)Arzt und Patient,<br />
in die elementare Rechtsgüter wie Persönlichkeitsrechte,<br />
körperliche Integrität usw. eingebracht werden, nicht gerecht.<br />
Der Arztvertrag hat mehr zu regeln als die bloße Kostenfrage,<br />
er betrifft Aufklärung und Einwilligung ebenso wie Wahl- und<br />
Selbstbestimmungsrechte oder Mitwirkungspflichten des<br />
Patienten. Angesichts der Grundrechtssensibilität der beteiligten<br />
Rechtsgüter und der Rechte-Pflichten-Relation im<br />
Kassenarztrecht müssen auch im Arzt-Patienten-Verhältnis die<br />
konstitutiven Elemente des Privatvertrages erhalten bleiben.<br />
Gerade der für seine individuelle Lebensplanung eigenverantwortliche<br />
Patient kann in seiner Persönlichkeitsentfaltung nicht<br />
so weit eingeschränkt werden, dass er auf anonyme Leistungsbeziehung<br />
verwiesen ist. Die Wiederbelebung privatvertraglicher<br />
Elemente innerhalb und außerhalb des Sachleistungssystems<br />
und seine Eingrenzung auf die Leistungsbereiche,<br />
die der sozialen Schutzfunktion der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
gerecht werden, ist eine rechtsstaatliche Aufgabe,<br />
die der Subjektstellung von (Zahn-)Arzt und Patient Rechnung<br />
trägt und der individualrechtlichen Prägung des Behandlungsverhältnisses<br />
gerecht wird.<br />
Haftungs- und europarechtliche Inkompatibilitäten<br />
Sie ist darüber hinaus erforderlich, um eine Kollision (zahn-)<br />
ärztlicher Pflichten im Spannungsfeld unterschiedlicher Anforderungen<br />
aufzulösen, die einerseits das an ökonomischen<br />
Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitskriterien ausgerichtete<br />
öffentlich-rechtliche Vertragsarztrecht, andererseits das am<br />
allgemeinen wissenschaftlich-medizinischen Standard orientierte<br />
zivilrechtliche Haftungsrecht an den (Zahn-)Arzt stellen:<br />
Im Sachleistungsprinzip des SGB V darf der Vertrags(zahn-)<br />
arzt neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nur anwenden,<br />
wenn der Bundesausschuss der Ärzte bzw. Zahnärzte<br />
und Krankenkassen diese Methoden anerkannt hat; gemäß<br />
zivilrechtlichem Arzthaftungsrecht hat der Vertrags(zahn-)arzt<br />
die Pflicht, seine Behandlung nach eigener Prüfung an den<br />
aktuellen medizinisch- wissenschaftlichen Standards auszurichten.<br />
Es besteht also ein ungelöstes Konfliktpotential<br />
zwischen der sozialversicherungsrechtlichen Wirtschaftlichkeitsanforderung<br />
(§ 12 Abs. 1 S. 2 SGB V) und dem zivilrechtlichen<br />
Haftungsmaßstab. Eine weitere Inadäquanz des<br />
Sachleistungsprinzips als leistungsrechtliches Handlungsforum<br />
betrifft die Europakompatibilität der Sachleistung.