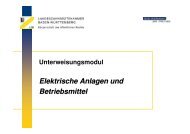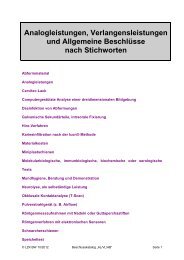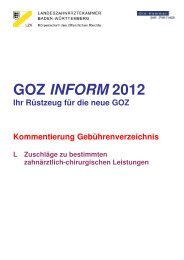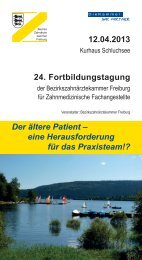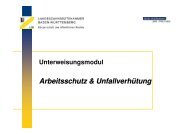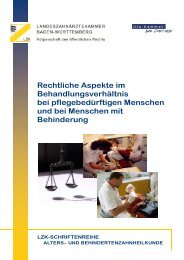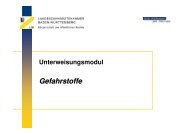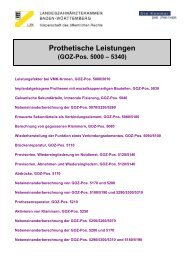Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
88 |<br />
auch zur grundsätzlichen Zulässigkeit der Ausgliederung von<br />
öffentlichen Aufgaben aus der unmittelbaren staatlichen Verwaltung<br />
und ihre Zuweisung an Träger funktionaler Selbstverwaltung<br />
nach. Daran schließt sich die für die Verortung der<br />
funktionalen Selbstverwaltung wichtige Feststellung an, dass<br />
Art. 20 Abs. 2 GG, der das Demokratieprinzip normiert, aufgrund<br />
seines Prinzipiencharakters entwicklungsoffen ist. Bei<br />
der Ausgestaltung des Demokratieprinzips komme es auf die<br />
Erfahrbarkeit und praktische Wirksamkeit der Legitimationsvermittlung<br />
an. Vor diesem Hintergrund erlaube das<br />
Grundgesetz auch besondere Formen der Beteiligung von<br />
Betroffenen bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben.<br />
Wörtlich heißt es dann:<br />
„Die funktionale Selbstverwaltung ergänzt und verstärkt<br />
insofern das demokratische Prinzip. Sie kann als Ausprägung<br />
dieses Prinzips verstanden werden, soweit sie der Verwirklichung<br />
des übergeordneten Ziels der freien Selbstbestimmung<br />
aller (...) dient. Demokratisches Prinzip und Selbstverwaltung<br />
stehen unter dem Grundgesetz nicht im Gegensatz<br />
zueinander. Sowohl das Demokratieprinzip in seiner traditionellen<br />
Ausprägung einer ununterbrochen auf das Volk zurückzuführenden<br />
Legitimationskette für alle Amtsträger als auch<br />
die funktionale Selbstverwaltung als organisierte Beteiligung<br />
der sachnahen Betroffenen an den sie berührenden Entscheidungen<br />
verwirklichen die sie verbindende Idee des sich selbst<br />
bestimmenden Menschen in einer freiheitlichen Ordnung (...).<br />
Das demokratische Prinzip des Art. 20 Abs. 2 GG erlaubt<br />
deshalb, durch Gesetz – also durch einen Akt des vom Volk<br />
gewählten Gesetzgebers – für abgegrenzte Bereiche der<br />
Erledigung öffentlicher Aufgaben besondere Organisationsformen<br />
der Selbstverwaltung zu schaffen. Dadurch darf<br />
zum einen ein wirksames Mitspracherecht der Betroffenen<br />
geschaffen und verwaltungsexterner Sachverstand aktiviert<br />
werden.“<br />
Im Sinne einer Gesamtwürdigung heißt es dann wenig später:<br />
„Gelingt es, die eigenverantwortliche Wahrnehmung einer<br />
öffentlichen Aufgabe mit privater Interessenwahrnehmung<br />
zu verbinden, so steigert dies die Wirksamkeit des parlamentarischen<br />
Gesetzes. Denn die an der Selbstverwaltung beteiligten<br />
Bürger nehmen die öffentliche Aufgabe dann auch im<br />
wohlverstandenen Eigeninteresse wahr; sie sind der öffentlichen<br />
Gewalt nicht nur passiv unterworfen, sondern an ihrer<br />
Ausübung aktiv beteiligt.“<br />
Mit diesen Ausführungen knüpft der Zweite Senat knapp und<br />
prägnant an die Leitbilder an, die bereits in der zweiten Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts die Bildung der Träger funktionaler Selbstverwaltung<br />
bestimmt haben. Sie werden jedoch nicht nur als<br />
historische Motivation zur Kenntnis genommen, sondern in die<br />
Entfaltung des demokratischen Prinzips des Art. 20 Abs. 2 GG<br />
harmonisch integriert. Praktische Wirksamkeit, die sinnvolle<br />
Nutzung privater Interessen als Potenzial für die staatsentlastende<br />
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und die unverzichtbare<br />
Letztverantwortung des Staatsvolkes in Gestalt des<br />
Gesetzgebers werden hier in ausgewogener und zugleich innovativer<br />
Form einander zugeordnet. Der Beschluss stellt damit<br />
eine wertvolle und wichtige Fortentwicklung sowohl des demokratischen<br />
Prinzips als auch der Integration der funktionalen<br />
Selbstverwaltung in den modernen Verfassungsstaat dar.<br />
Der immer wieder erklingende Vorwurf, es handle sich bei den<br />
Kammern und der funktionalen Selbstverwaltung um ein ständestaatliches<br />
Relikt, dürfte damit endgültig überwunden sein.<br />
Die Bewertung des Kammerwesens im Lichte der neueren<br />
Dokumente und Rechtsakte der Europäischen Union<br />
Ein erstes wichtiges Dokument für die Einschätzung der Rolle,<br />
die die EU-Kommission den Kammern zuweist, stellt das Weissbuch<br />
Europäisches Regieren vom 25. Juli 2001 dar. Das durch<br />
Wissenschaft und Praxis sehr kritisch aufgenommene Dokument<br />
spiegelt in seinen Grundorientierungen weiterhin die Zielsetzungen<br />
der EU-Politik für die Einbeziehung der Bürger und die<br />
Zusammenarbeit mit den Verwaltungen der Mitgliedstaaten wieder.<br />
Das Konzept des „Guten Regierens“ wird in dem Weissbuch<br />
vor allem durch die Begriffe Offenheit und Partizipation sowie<br />
neue Formen der Zusammenarbeit, insbesondere das Modell der<br />
Ko-Regulierung sowie der offenen Koordinierung, konkretisiert.<br />
Auf die Kammern wird dabei zumeist unter dem Obergriff der<br />
Berufsorganisationen Bezug genommen, die einerseits als<br />
Partner der Ko-Regulierung und offenen Koordinierung angeführt<br />
werden, andererseits aber auch Mittler der Partizipation der<br />
Unionsbürger sind. Die Betonung der partizipativen Demokratie<br />
in Art. 46 des EU-Verfassungsentwurfs stellt eine konsequente<br />
Fortschreibung dieses Ansatzes dar. Dabei kann an die dogmatische<br />
Konzeption der funktionalen Selbstverwaltung, wie sie das<br />
Bundesverfassungsgericht in seiner jüngeren Rechtsprechung<br />
weiter entfaltet hat, nahtlos angeknüpft werden.