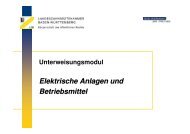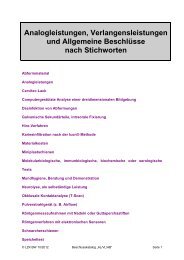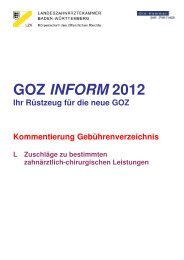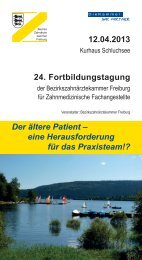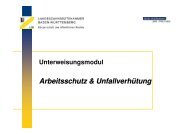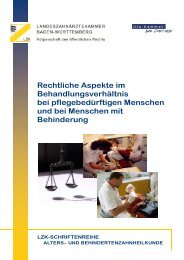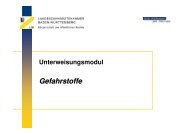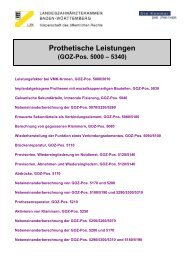Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 50 Jahre ... - Lzk Bw
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
seinem so genannten Facharztbeschluss die Verwurzelung der<br />
Selbstverwaltungskonzeption im Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip<br />
betont (BVerfGE 33, 125, 157 und 159). Zugleich wurden<br />
sowohl in dieser Entscheidung und in den späteren Entscheidungen<br />
zu den Standesrichtlinien der Rechtsanwaltschaft<br />
(BVerfGE 76, 171 ff.) die Anforderungen an die Rechtsetzung<br />
durch Kammern präzisiert. Dabei wurde zum einen die Reichweite<br />
der Regelungen im grundrechtsrelevanten Bereich mit<br />
Hilfe der Lehre vom Parlamentsvorbehalt beschränkt und zum<br />
anderen die Anforderungen an die Legitimation der Kammerorgane,<br />
die berufsrechtliche Regelungen erlassen, konkretisiert.<br />
Als Zwischenbilanz kann damit festgehalten werden, dass<br />
die Kammern sowohl im Hinblick auf ihre Organisationsform<br />
als auch hinsichtlich der ihnen zugewiesenen Aufgaben als<br />
verfassungskonform zu qualifizieren sind.<br />
Neue Akzente in der jüngeren Rechtsprechung des<br />
Bundesverfassungsgerichts<br />
In drei Entscheidungen aus den <strong>Jahre</strong>n 2001 und 2002 hat das<br />
Bundesverfassungsgericht seine bisherige Rechtsprechung<br />
nicht nur bestätigt, sondern durch eine weitergehende<br />
Argumentation auch die Verankerung des Typus funktionale<br />
Selbstverwaltung im Grundgesetz weiter verdeutlicht.<br />
Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts<br />
hat sich in zwei Beschlüssen vom 13. Dezember 2001<br />
und 8. März 2002 geäußert (BVerfG, NVwZ 2002, 335 und 851).<br />
Im ersten Beschluss ging es um die Frage, ob die gesetzliche<br />
Pflichtmitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern<br />
trotz veränderter Rahmenbedingungen weiterhin mit dem<br />
Grundgesetz vereinbar ist. Dies hat das Bundesverfassungsgericht<br />
bei gleichzeitiger Bestätigung des bisherigen verfassungsrechtlichen<br />
Prüfungsmaßstabes bejaht. Es hat aber<br />
zugleich deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber den<br />
Fortbestand der legitimierenden Voraussetzungen für die<br />
Kammerorganisation von Zeit zu Zeit überprüfen muss. Dies<br />
war in Bezug auf die Industrie- und Handelskammern<br />
jedoch geschehen. Von Bedeutung und weiterführend ist<br />
im Beschluss vom 15. Dezember 2001, dass auch auf die<br />
legitimatorische und freiheitssichernde Funktion der gesetzlichen<br />
Pflichtmitgliedschaft hingewiesen wird.<br />
Prof. Dr. Winfried Kluth<br />
Damit wird, ohne dass die Zusammenhänge im Einzelnen entfaltet<br />
werden, die partizipatorische und damit rechtsbegründende<br />
Dimension der Mitgliedschaft in den Kammern<br />
angesprochen, auf die auch in der wissenschaftlichen Literatur<br />
hingewiesen wird.<br />
In einem weiteren Beschluss vom 8. März 2002 hat sich die<br />
2. Kammer des Ersten Senats mit der Frage beschäftigt, ob sich<br />
eine <strong>Landeszahnärztekammer</strong> dem Versorgungswerk einer anderen<br />
Zahnärztekammer anschließen und der Satzungsgewalt<br />
unterwerfen kann, ohne dass in den für die Rechtsetzung zuständigen<br />
Organen entsprechende Mitwirkungsrechte eingeräumt<br />
werden. Eine solche Regelung ist nach den Ausführungen<br />
des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgedanken der<br />
Selbstverwaltung, wie er in den Kammern verwirklicht wird,<br />
nicht zu vereinbaren. Wörtlich heißt es: „Ein solcher Verzicht<br />
auf Partizipation für gegenwärtige und künftige Mitglieder liegt<br />
nicht in der autonomen Kompetenz einer Satzungsversammlung<br />
und wird auch der Verbindung des Prinzips der Selbstverwaltung<br />
zum demokratischen Prinzip (vgl. BVerfGE 33, 125, 159)<br />
nicht gerecht“ (BVerfG, NVwZ 2002, 851, 852). Dieser Beschluss<br />
macht deutlich, dass der prägende Charakter der betroffenen<br />
Selbstverwaltung auch nicht aus pragmatischen Überlegungen<br />
disponibel ist, wenn es in erster Linie darum geht, Dienstleistungen<br />
zugunsten der Mitglieder zu erbringen. Inwieweit<br />
die Maßstäbe dieses Beschlusses auch auf privatrechtlich<br />
organisierte Dienstleistungsunternehmen der Kammern zu<br />
übertragen sind, bedarf einer genaueren Prüfung.<br />
Die zeitlich letzte und in Umfang und Aussagegehalt<br />
bedeutsamste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts<br />
stellt der Beschluss des Zweiten Senats vom 5. Dezember 2002<br />
(BVerfGE 107, 59 ff.) zur Frage der Zulässigkeit der Arbeitnehmermitbestimmung<br />
in Wasserverbänden, die den Typus<br />
der Realkörperschaften innerhalb der funktionalen Selbstverwaltung<br />
repräsentieren, dar. Auch wenn man der Entscheidung<br />
im konkreten Ergebnis und den dogmatischen<br />
Einzelheiten nicht folgt, stellt sie einen bedeutsamen Beitrag<br />
für die Verortung der funktionalen Selbstverwaltung in der<br />
Verfassungsordnung dar.<br />
Der Zweite Senat zeichnet zunächst sowohl seine Rechtsprechung<br />
zu den Anforderungen an die demokratische<br />
Legitimation in der Staats- und Kommunalverwaltung als<br />
| 87