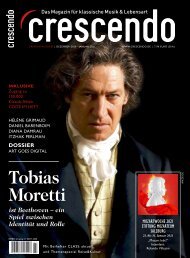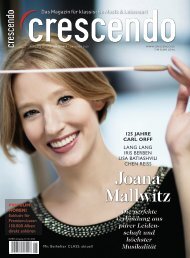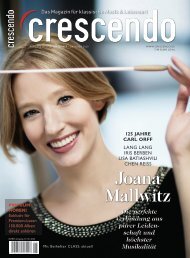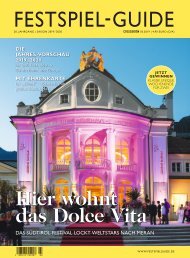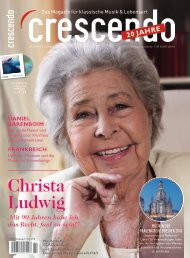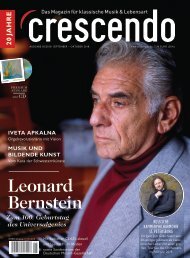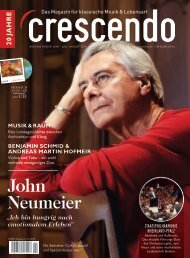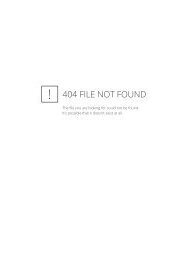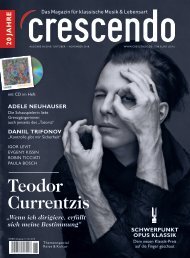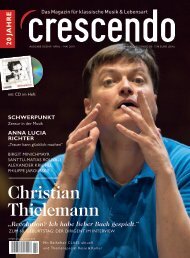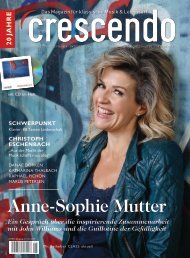CRESCENDO 4/19 Juni-August 2019
CRESCENDO – das Magazin für klassische Musik und Lebensart. Interviews unter anderem mit Gidon Kremer, Augustin Hadelich, Benjamin Schmid und Maurice Steger.
CRESCENDO – das Magazin für klassische Musik und Lebensart.
Interviews unter anderem mit Gidon Kremer, Augustin Hadelich, Benjamin Schmid und Maurice Steger.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Chef ernannt und wird kommende Saison mit der Staatskapelle<br />
Dresden, dem Gewandhausorchester und dem Orchester des BR<br />
auftreten. Das Concertgebouw, das ihn einst wegen der sexuellen<br />
Übergriffe entlassen hat, gab kürzlich eine Pressemeldung heraus,<br />
dass man dem ehemaligen Chef danke, ihm viel Glück wünsche<br />
und dass man von nun an in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit<br />
blicken wolle.<br />
Und auch nach der neuen Veröffentlichung im „Spiegel“ bleibt<br />
es weitgehend still. Keine der Hochschulen hat ernsthaft darüber<br />
nachgedacht, konkret zu handeln (einer der Professoren, dem<br />
sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, ist noch immer im Amt).<br />
Dabei gibt es immer mehr Stimmen von Opfern. Ich habe mich<br />
mit einem der Autoren des „Spiegel“-Texts unterhalten. Er hat mir<br />
Mails von weiteren Frauen weitergeleitet, die ähnliche Geschichten<br />
berichten. Es ist längst klar, dass sexuelle Übergriffe an unseren<br />
Hochschulen keine Einzelfälle sind. Dennoch gibt es keinerlei<br />
Codex an den Institutionen, durch den zumindest das Machtgefüge<br />
aufgehoben würde. Es wäre ein Leichtes, seine Lehrkräfte<br />
dazu aufzufordern, dass ihre Schüler, wenn sie in einem sexuellen<br />
Verhältnis zum Lehrer stehen, den Lehrer<br />
wechseln – um nicht in die Gefahr zu kommen,<br />
sexuell abhängig zu werden. Aber nichts davon.<br />
Stattdessen: Schweigen im Klassik-Wald. Aussitzen.<br />
Wegschauen. Weghören.<br />
Warum aber ist es so, dass wir besonders<br />
in der Welt der klassischen Musik mit sexuellen<br />
Übergriffen zu tun haben? Es scheint ein System<br />
zu sein, das Methode schafft. Das System der<br />
Klassik unterscheidet sich in vielen Dingen von<br />
anderen gesellschaftlichen Bereichen wie etwa<br />
dem Sport oder der Politik. Zum einen haben<br />
wir es noch immer mit dem uralten Mythos des<br />
Genies zu tun. Mit dem alten, bürgerlichen Glauben,<br />
große Kunst müsse unkonventionell sein, ein Genie könne nur<br />
dann kreativ sein, wenn es die Grenzen der Konventionen überschreitet<br />
– und dazu gehört für viele eben auch die erotische Freiheit.<br />
Eigentlich müssten wir im 21. Jahrhundert längst gelernt<br />
haben, dass der Geniekult des <strong>19</strong>. Jahrhunderts nur ein Mythos<br />
war. Jeden Tag beweisen große Künstler, dass man große Kunst<br />
auch mit demokratischen Mitteln erreichen kann, mit fairem Verhalten<br />
gegenüber seinen Mitkünstlern und, ja, vollkommen skandalfrei.<br />
Es ist höchste Zeit, dass auch wir als Publikum aufhören zu<br />
glauben, dass große Kunst nur von großen Arschlöchern gemacht<br />
werden kann.<br />
Eine weitere systemische Eigenheit der Klassik ist, dass ihr<br />
die Instanz einer wirklich kritischen und freien Presse weitgehend<br />
abgeht. Im Feuilleton spielt die klassische Musik kaum noch<br />
eine Rolle, und wenn, gibt es kaum noch einen Journalisten, der<br />
nicht in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zu jenen Künstlern<br />
steht, über die er berichtet: Da ist die Einladung zu einer Konzertreise<br />
nach Abu Dhabi oder der Auftrag, ein Booklet oder ein<br />
Programmheft für einen Künstler oder ein Orchester zu schreiben.<br />
Keine Redaktion in Deutschland, nicht einmal die großer<br />
Zeitungen, ist noch in der Lage, einen Kritiker aus eigener Kasse<br />
nach, sagen wir, New York fliegen zu lassen. Meist werden diese<br />
Reisen von den Orchestern oder den Veranstaltern gezahlt. Freie<br />
und kritische Berichterstattung ist damit so gut wie ausgeschlossen.<br />
Hinzu kommt, dass die meisten Klassik-Journalisten nicht aus<br />
dem Journalismus kommen, sondern aus der Musik. Anders als im<br />
Sport oder in der Politik liegt damit der Fokus in der Regel nicht<br />
auf der sozialen Komponente der Kunst, sondern auf ihrer qualitativen<br />
musikalischen Umsetzung.<br />
SCHWEIGEN IM<br />
KLASSIK-WALD.<br />
AUSSITZEN.<br />
WEGSCHAUEN.<br />
WEGHÖREN<br />
Das, aber auch die Nischenkultur der Klassik, sorgt dafür,<br />
dass sowohl Hochschulen als auch Orchester und Theater Mikrokosmen<br />
sind, die kaum unter öffentlicher Beobachtung stehen, die<br />
es kaum noch gewohnt sind, sich für ihre staatlichen Subventionen<br />
öffentlich zu legitimieren, die weitgehend unter dem Radar<br />
der öffentlichen Kontrolle hindurchsegeln und die in der Regel<br />
mit eigenen, veralteten Hierarchien geführt werden. Kein Wunder,<br />
dass sich in dieser kleinen Welt, die ihre eigenen Helden hat,<br />
Strukturen etablieren, die kein Korrektiv mehr kennen. Es ist<br />
doch bezeichnend, dass sexuelle Übergriffe sogar an Musikhochschulen<br />
wie jener in Hamburg stattfinden, die nach außen eine<br />
besonders starke Gender-Fraktion haben und von liberalen Kräften<br />
geleitet werden. Aber wenn es um Forschungsgelder oder neue<br />
Aufträge geht, scheinen die eigenen Prinzipien über Bord geworfen<br />
zu werden.<br />
Und damit sind wir bei einem weiteren Merkmal der Klassik-<br />
Kultur: Während hochsubventionierte Klassik-Stars und Dirigenten<br />
(keiner von ihnen finanziert seine Abendgagen allein durch die<br />
Eintrittskarten) andauernd hofiert werden, als seien sie weltweite<br />
Superstars, glauben sie allmählich wirklich, dass<br />
sie unantastbar sind. Gleichzeitig zeigen die<br />
Erfahrungen der letzten Jahre, dass die Kulturpolitik<br />
weniger Interesse an den inneren Strukturen<br />
von Hochschulen, Theatern oder Orchestern<br />
haben als an der glamourösen Außenwirkung<br />
der Ensembles und ihrer Leiter. Oft ist es<br />
der Kulturpolitik wichtiger, eine schillernde<br />
Dirigenten-Persönlichkeit zu verpflichten, als<br />
sich die Mühe zu machen, die inneren Strukturen<br />
der Ensembles unter die Lupe zu nehmen.<br />
Doch genau an dieser Stelle scheint<br />
sich nun etwas zu tun. Während viele Theater,<br />
Orchester und Musikhochschulen noch in<br />
ihrem eigenen Saft schmoren, wird der Druck auf die Kulturpolitik<br />
durch die aktuelle Berichterstattung immer größer. Und so<br />
war es dann eben auch nicht die Leitung der Hochschulen, die die<br />
Beschwerden der Opfer ernst genommen hat, sondern die Politik.<br />
Und es ist das, was uns am Ende an der #MeToo-Debatte in der<br />
Klassik optimistisch stimmen könnte. Allmählich entsteht ein<br />
Bewusstsein, dass etwas nicht stimmt in der Welt, die uns eigentlich<br />
den Geist des Humanismus und der Menschenliebe eröffnen<br />
soll. Dafür aber ist es wichtig, dass auch wir als Publikum<br />
nicht wegschauen, dass wir als Journalisten dranbleiben, auch<br />
wenn Themen wie sexuelle Übergriffe der Schönheit der Kunst im<br />
Wege stehen. Dass wir aus der Welt der Klassik, und gerade aus<br />
der Welt der Oper, lernen, dass Madame Butterfly, Carmen, Tosca<br />
oder Salome eben keine Kunstfiguren sind, deren Schicksal sich<br />
erledigt hat, sobald der Vorhang gefallen ist, sondern dass sie auch<br />
dann unter uns sind, wenn wir das Theater verlassen.<br />
Wenn wir die Welt der klassischen Musik wieder in Ordnung<br />
bringen wollen, dürfen wir nicht wegschauen, uns nicht gelangweilt<br />
abwenden, keine Angst haben hinzuschauen und aufzuschreien<br />
– wir dürfen uns nicht einreden, dass die Musik als Wert<br />
an sich groß genug ist und wir uns nicht um die Bedingungen ihrer<br />
Produktion kümmern müssen. Das wäre so, als würden wir ein<br />
Schnitzel nach dem anderen in uns hineinstopfen, ohne zu fragen,<br />
woher es kommt. Gerade das Klassik-Publikum sollte sensibilisiert<br />
für jede Form der Ungerechtigkeit sein und in zahlreichen Konzerten<br />
und Opern gelernt haben, wie wichtig es ist, aufzustehen<br />
und Missstände anzuklagen – immer und immer wieder, bis sich<br />
die Strukturen geändert haben.<br />
■<br />
43