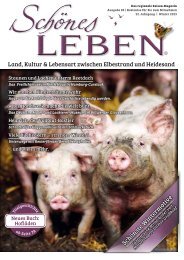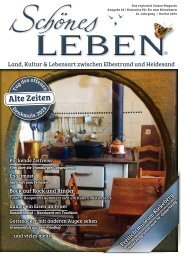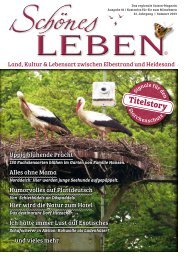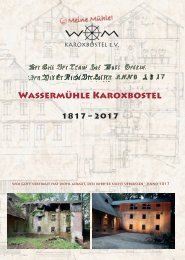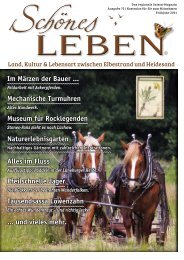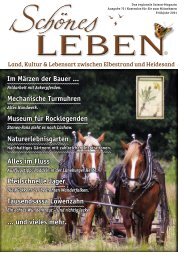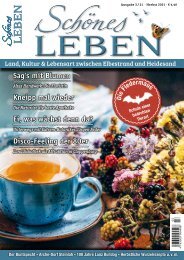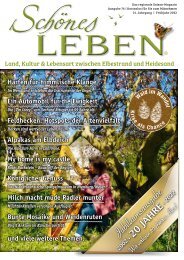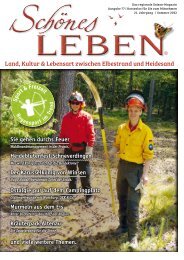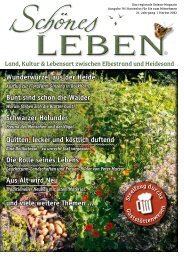Schönes Leben – Ausgabe 73
Land, Kultur und Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand
Land, Kultur und Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
abgebaut sein müssen. Stattdessen wächst Terra Preta munter weiter,<br />
ähnlich wie in unseren Breiten die Torfmoore. Wie kann das sein nach<br />
Hunderten, ja, sogar Tausenden von Jahren? „Die fast beispiellose<br />
Fruchtbarkeit von Terra Preta do Indio ist ein wissenschaftliches Phänomen<br />
und hängt auch damit zusammen, dass diese Böden einen sehr<br />
hohen Anteil organischer Substanz aufweisen. Heute wissen wir, dass<br />
die indigene Bevölkerung am Amazonas Terra Preta aus ihren Siedlungsabfällen<br />
mittels anaerober Fermentation herstellten“, sagt Joachim<br />
Böttcher.<br />
Überall, wo im Regenwald Terra Preta gefunden wird, finden sich auch<br />
große Mengen von Tonscherben. Diese stammen von großen, zum Teil<br />
heute noch erhaltenen, oft reich mit Ornamenten verzierten Tongefäßen.<br />
Schätzungen von Archäologen ergaben die gewaltige Anzahl von<br />
8.000 bis 12.000 Gefäßen pro Hektar. „Somit lag es auf der Hand,<br />
dass diese Gefäße mit der Herstellung der Terra Preta im Zusammenhang<br />
standen“, sagt Joachim Böttcher. Er beschreibt die historische<br />
Terra Preta-Herstellung wie folgt: „Zunächst wurden die Gefäß-Rohlinge<br />
durch die Verschwelung von holzartiger Biomasse im Inneren des<br />
Gefäßes gebrannt. Dieser Prozess wurde vorwiegend unter Luftabschluss<br />
durchgeführt, wozu die Gefäße mit Deckeln verschlossen waren.<br />
Die fertige Holzkohle wurde teilweise für Kochzwecke entnommen,<br />
während das krümelige Material im Gefäß verblieb. Nun wurden organische<br />
Siedlungsabfälle eingefüllt, wie beispielsweise Essens- und<br />
Ernte reste, Fischgräten, Geflügelknochen aber auch menschliche Fäkalien.<br />
Es wurde stets darauf geachtet, dass der Behälter wieder luftdicht<br />
verschlossen wurde, um Gerüche zu vermeiden und Insekten fernzuhalten.“<br />
Nach Angaben des Terra Preta-Pioniers ist die anaerobe Stabilisierung<br />
der organischen Inhaltsstoffe beim Herstellungsprozess enorm wichtig,<br />
denn bei zu viel Luftzufuhr wäre es unter den subtropischen Bedingungen<br />
im Regenwald sehr schnell zu einem aeroben biologischen Abbau<br />
der organischen Substanz gekommen. Für die indigene Bevölkerung<br />
aber sei jedes Gramm organischer Substanz zur Fruchtbarmachung<br />
ihrer Böden wertvoll gewesen, da die normalen Regenwaldböden extrem<br />
unfruchtbar sind. Nach der vollständigen Befüllung eines Gefäßes<br />
mit Holzkohle und organischen Siedlungsabfällen hätten die Indios das<br />
Gemisch unter Luftabschluss einige Wochen stehen gelassen. „Dabei<br />
entsteht ein anaerober Fermentationsprozess, wodurch der pH-Wert<br />
zwischenzeitlich auf bis 4 absinken kann. In diesem sauren Milieu<br />
werden Krankheitserreger wirksam eliminiert. Nach der vollständigen<br />
Fermentierung der Holzkohle-Biomasse-Mischung wurde wahrscheinlich<br />
der obere Teil des Behälters zerschlagen, sodass eine Art Hochbeet<br />
entstand, in dem die Kulturpflanzen in der fruchtbaren Schwarzerde<br />
gedeihen konnten“, erklärt Joachim Böttcher.<br />
Die indigene Bevölkerung nutzte<br />
jedes Gramm organischer Substanz<br />
zur Fruchtbarmachung der Böden.<br />
Der 58-jährige Pfälzer gehörte zu einer Expertengruppe aus Deutschland,<br />
der 2005 erstmals die Reproduktion dieser Erde gelang. Das<br />
Expertenteam stellte aus Holzkohle, heute meist als „Pflanzen- oder<br />
Biokohle“ bezeichnet, und anderen organischen Materialien unter<br />
Anwendung eines anaeroben Fermentationsverfahrens erstmalig Substrate<br />
her, welche sowohl vom Aussehen als auch von den Eigenschaften<br />
der Terra Preta aus dem Regenwald sehr nahekamen. Aufgrund ihrer<br />
sehr großen Oberfläche kann die Pflanzenkohle die Nährstoff- und<br />
Wasserhaltefähigkeit des Bodens deutlich verbessern. „Doch die Pflanzenkohle<br />
allein macht noch lange keine Terra Preta. Das haben auch<br />
groß angelegte Versuche in den USA und in Australien gezeigt“, weiß<br />
Joachim Böttcher. Er vermutete, dass über die hochporöse Pflanzenkohle<br />
in Verbindung mit einem speziellen Fermentationsverfahren<br />
bestimmte Mikroorganismen besonders gefördert werden, während<br />
andere Mikroben-Stämme, vorwiegend Krankheits- und Schaderreger,<br />
wirksam unterdrückt werden. Der wissenschaftliche Beweis für diese<br />
In der Pfalz werden durch den Einsatz von Palaterra, der fruchtbaren Schwarzerde, die Joachim Böttcher nach dem Vorbild der Terra Preta do Indio produziert,<br />
die Ertäge im Weinbau verbessert, ohne dass der Boden und das Grundwasser belastet werden.<br />
78 Sommer 2021