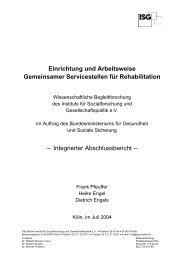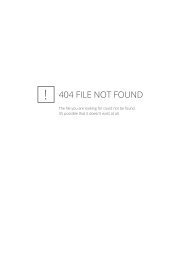Armutsbericht der Stadt Konstanz - ISG
Armutsbericht der Stadt Konstanz - ISG
Armutsbericht der Stadt Konstanz - ISG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Armutsbericht</strong> <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Konstanz</strong><br />
de Verständnis von Armut kommt im Konzept <strong>der</strong> „Lebenslage“ zum Ausdruck, das seit<br />
Mitte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts in <strong>der</strong> Sozialwissenschaft ausgearbeitet wurde und auch<br />
<strong>der</strong> Armuts- und Reichtumsberichterstattung auf nationaler Ebene als Leitprinzip dient. 5<br />
Dem Lebenslagenansatz liegt ein weit gefasstes Verständnis von Armut zugrunde, das<br />
neben den materiellen Lebensverhältnissen auch weitere Einflussfaktoren wie Bildung,<br />
Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Wohnsituation, Trennung und Alleinerziehung,<br />
soziale Netzwerke und an<strong>der</strong>es berücksichtigt. 6 Zwar darf das Gewicht des<br />
finanziellen Faktors nicht übersehen werden – monetäre Armut hat auch innerhalb des<br />
Lebenslagekonzeptes einen zentralen Stellenwert und wirkt sich in an<strong>der</strong>en Dimensionen<br />
des Lebens aus; z.B. wohnen in Substandardwohnungen in <strong>der</strong> Regel Haushalte<br />
mit geringem Einkommen. Es gibt aber auch Defizite, die mit zusätzlichen finanziellen<br />
Mitteln nicht zu beheben sind: So wird z.B. im Falle von Ehescheidung und <strong>der</strong>en psycho-sozialen<br />
Folgen o<strong>der</strong> auch bei Krankheit, Behin<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit<br />
und <strong>der</strong>en psycho-somatischen Folgen die Lebenslage von Faktoren bestimmt, die<br />
nicht unmittelbar mit dem Einkommen und Vermögen in Zusammenhang stehen.<br />
Ursprünglich wurde das Konzept <strong>der</strong> „Lebenslage“ mit unterschiedlichen Akzentuierungen<br />
formuliert: Otto Neurath, <strong>der</strong> diesen Begriff einführte, betont die Mehrdimensionalität<br />
<strong>der</strong> Lebensumstände und <strong>der</strong>en subjektive Perzeption, wenn er „Lebenslage“ definiert<br />
als den „Inbegriff all <strong>der</strong> Umstände, die verhältnismäßig unmittelbar die Verhaltensweise<br />
eines Menschen, seinen Schmerz, seine Freude bedingen. Wohnung, Nahrung,<br />
Kleidung, Gesundheitspflege, Bücher, Theater, freundliche menschliche Umgebung,<br />
all das gehört zur Lebenslage ...“ 7 Gerhard Weisser legt in einer Weiterentwicklung<br />
dieses Konzepts den Akzent stärker auf die Handlungsmöglichkeiten zur Realisierung<br />
von Lebenschancen; unter einer „Lebenslage“ versteht er den „Spielraum, den<br />
einem Menschen (einer Gruppe von Menschen) die äußeren Umstände nachhaltig für<br />
die Befriedigung <strong>der</strong> Interessen bieten, die den Sinn seines Lebens bestimmen.“ 8<br />
In Anknüpfung daran wird das Lebenslagekonzept heute einerseits als Multidimensionalität<br />
<strong>der</strong> objektiven gesellschaftlichen Lebensbedingungen interpretiert und an<strong>der</strong>erseits<br />
als subjektive Nutzung von Handlungsspielräumen auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> persönlichen<br />
Fähigkeiten und Ressourcen, mit denen <strong>der</strong> Einzelne ausgestattet ist. 9 Wie in<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.), Lebenslagen in Deutschland.<br />
Der erste Armuts- und Reichtumsbericht <strong>der</strong> Bundesregierung, Bonn 2001<br />
D. Engels/ C. Sellin, Konzept- und Umsetzungsstudie zur Vorbereitung des Armuts- und<br />
Reichtumsberichtes <strong>der</strong> Bundesregierung, Forschungsbericht des Bundesministeriums<br />
für Arbeit und Sozialordnung Nr. 278, Bonn 1999<br />
O. Neurath, Empirische Soziologie, 1931, zit. nach W. Glatzer/ W. Hübinger, Lebenslagen<br />
und Armut, in: Döring/ Hanesch/ Huster 1990, S. 31 ff, hier S. 35<br />
G. Weisser, Artikel „Wirtschaft“, in: W. Ziegenfuss (Hrsg.), Handbuch <strong>der</strong> Soziologie,<br />
Stuttgart 1956, S. 986<br />
Zur aktuellen Diskussion vgl. D. Engels (Red. Bearb.), Tagungsdokumentation „Perspektiven<br />
<strong>der</strong> Armuts- und Reichtumsberichterstattung in Deutschland“, hrsg. vom Bundesmi-<br />
3