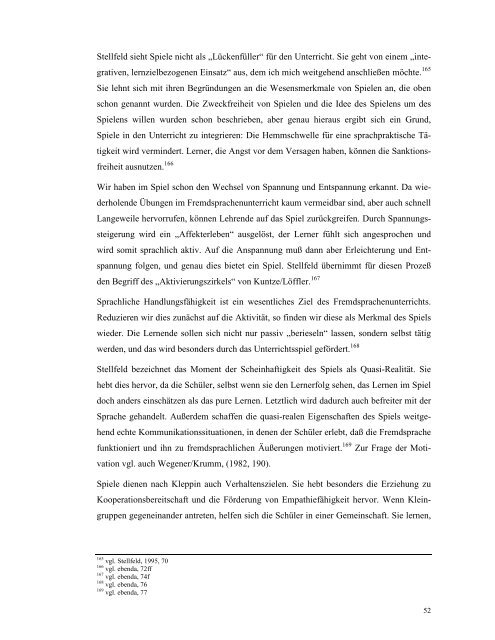Kommunikation im Internet - Sprachen Interaktiv
Kommunikation im Internet - Sprachen Interaktiv
Kommunikation im Internet - Sprachen Interaktiv
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stellfeld sieht Spiele nicht als „Lückenfüller“ für den Unterricht. Sie geht von einem „inte-<br />
grativen, lernzielbezogenen Einsatz“ aus, dem ich mich weitgehend anschließen möchte. 165<br />
Sie lehnt sich mit ihren Begründungen an die Wesensmerkmale von Spielen an, die oben<br />
schon genannt wurden. Die Zweckfreiheit von Spielen und die Idee des Spielens um des<br />
Spielens willen wurden schon beschrieben, aber genau hieraus ergibt sich ein Grund,<br />
Spiele in den Unterricht zu integrieren: Die Hemmschwelle für eine sprachpraktische Tä-<br />
tigkeit wird vermindert. Lerner, die Angst vor dem Versagen haben, können die Sanktions-<br />
freiheit ausnutzen. 166<br />
Wir haben <strong>im</strong> Spiel schon den Wechsel von Spannung und Entspannung erkannt. Da wie-<br />
derholende Übungen <strong>im</strong> Fremdsprachenunterricht kaum vermeidbar sind, aber auch schnell<br />
Langeweile hervorrufen, können Lehrende auf das Spiel zurückgreifen. Durch Spannungs-<br />
steigerung wird ein „Affekterleben“ ausgelöst, der Lerner fühlt sich angesprochen und<br />
wird somit sprachlich aktiv. Auf die Anspannung muß dann aber Erleichterung und Ent-<br />
spannung folgen, und genau dies bietet ein Spiel. Stellfeld übern<strong>im</strong>mt für diesen Prozeß<br />
den Begriff des „Aktivierungszirkels“ von Kuntze/Löffler. 167<br />
Sprachliche Handlungsfähigkeit ist ein wesentliches Ziel des Fremdsprachenunterrichts.<br />
Reduzieren wir dies zunächst auf die Aktivität, so finden wir diese als Merkmal des Spiels<br />
wieder. Die Lernende sollen sich nicht nur passiv „berieseln“ lassen, sondern selbst tätig<br />
werden, und das wird besonders durch das Unterrichtsspiel gefördert. 168<br />
Stellfeld bezeichnet das Moment der Scheinhaftigkeit des Spiels als Quasi-Realität. Sie<br />
hebt dies hervor, da die Schüler, selbst wenn sie den Lernerfolg sehen, das Lernen <strong>im</strong> Spiel<br />
doch anders einschätzen als das pure Lernen. Letztlich wird dadurch auch befreiter mit der<br />
Sprache gehandelt. Außerdem schaffen die quasi-realen Eigenschaften des Spiels weitge-<br />
hend echte <strong>Kommunikation</strong>ssituationen, in denen der Schüler erlebt, daß die Fremdsprache<br />
funktioniert und ihn zu fremdsprachlichen Äußerungen motiviert. 169 Zur Frage der Moti-<br />
vation vgl. auch Wegener/Krumm, (1982, 190).<br />
Spiele dienen nach Kleppin auch Verhaltenszielen. Sie hebt besonders die Erziehung zu<br />
Kooperationsbereitschaft und die Förderung von Empathiefähigkeit hervor. Wenn Klein-<br />
gruppen gegeneinander antreten, helfen sich die Schüler in einer Gemeinschaft. Sie lernen,<br />
165 vgl. Stellfeld, 1995, 70<br />
166 vgl. ebenda, 72ff<br />
167 vgl. ebenda, 74f<br />
168 vgl. ebenda, 76<br />
169 vgl. ebenda, 77<br />
52