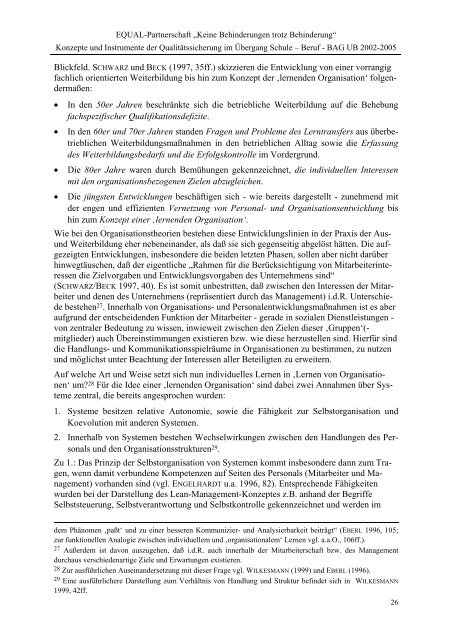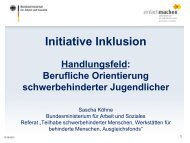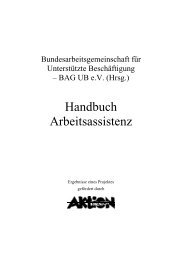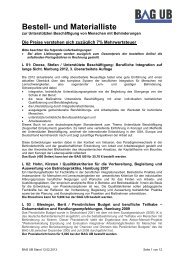Download - BAG UB eV
Download - BAG UB eV
Download - BAG UB eV
- TAGS
- download
- www.bag-ub.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EQUAL-Partnerschaft „Keine Behinderungen trotz Behinderung“<br />
Konzepte und Instrumente der Qualitätssicherung im Übergang Schule – Beruf - <strong>BAG</strong> <strong>UB</strong> 2002-2005<br />
Blickfeld. SCHWARZ und BECK (1997, 35ff.) skizzieren die Entwicklung von einer vorrangig<br />
fachlich orientierten Weiterbildung bis hin zum Konzept der ‚lernenden Organisation‘ folgendermaßen:<br />
� In den 50er Jahren beschränkte sich die betriebliche Weiterbildung auf die Behebung<br />
fachspezifischer Qualifikationsdefizite.<br />
� In den 60er und 70er Jahren standen Fragen und Probleme des Lerntransfers aus überbetrieblichen<br />
Weiterbildungsmaßnahmen in den betrieblichen Alltag sowie die Erfassung<br />
des Weiterbildungsbedarfs und die Erfolgskontrolle im Vordergrund.<br />
� Die 80er Jahre waren durch Bemühungen gekennzeichnet, die individuellen Interessen<br />
mit den organisationsbezogenen Zielen abzugleichen.<br />
� Die jüngsten Entwicklungen beschäftigen sich - wie bereits dargestellt - zunehmend mit<br />
der engen und effizienten Vernetzung von Personal- und Organisationsentwicklung bis<br />
hin zum Konzept einer ‚lernenden Organisation‘.<br />
Wie bei den Organisationstheorien bestehen diese Entwicklungslinien in der Praxis der Ausund<br />
Weiterbildung eher nebeneinander, als daß sie sich gegenseitig abgelöst hätten. Die aufgezeigten<br />
Entwicklungen, insbesondere die beiden letzten Phasen, sollen aber nicht darüber<br />
hinwegtäuschen, daß der eigentliche „Rahmen für die Berücksichtigung von Mitarbeiterinteressen<br />
die Zielvorgaben und Entwicklungsvorgaben des Unternehmens sind“<br />
(SCHWARZ/BECK 1997, 40). Es ist somit unbestritten, daß zwischen den Interessen der Mitarbeiter<br />
und denen des Unternehmens (repräsentiert durch das Management) i.d.R. Unterschiede<br />
bestehen27 . Innerhalb von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen ist es aber<br />
aufgrund der entscheidenden Funktion der Mitarbeiter - gerade in sozialen Dienstleistungen -<br />
von zentraler Bedeutung zu wissen, inwieweit zwischen den Zielen dieser ‚Gruppen‘(mitglieder)<br />
auch Übereinstimmungen existieren bzw. wie diese herzustellen sind. Hierfür sind<br />
die Handlungs- und Kommunikationsspielräume in Organisationen zu bestimmen, zu nutzen<br />
und möglichst unter Beachtung der Interessen aller Beteiligten zu erweitern.<br />
Auf welche Art und Weise setzt sich nun individuelles Lernen in ‚Lernen von Organisationen‘<br />
um? 28 Für die Idee einer ‚lernenden Organisation‘ sind dabei zwei Annahmen über Systeme<br />
zentral, die bereits angesprochen wurden:<br />
1. Systeme besitzen relative Autonomie, sowie die Fähigkeit zur Selbstorganisation und<br />
Koevolution mit anderen Systemen.<br />
2. Innerhalb von Systemen bestehen Wechselwirkungen zwischen den Handlungen des Personals<br />
und den Organisationsstrukturen29 .<br />
Zu 1.: Das Prinzip der Selbstorganisation von Systemen kommt insbesondere dann zum Tragen,<br />
wenn damit verbundene Kompetenzen auf Seiten des Personals (Mitarbeiter und Management)<br />
vorhanden sind (vgl. ENGELHARDT u.a. 1996, 82). Entsprechende Fähigkeiten<br />
wurden bei der Darstellung des Lean-Management-Konzeptes z.B. anhand der Begriffe<br />
Selbststeuerung, Selbstverantwortung und Selbstkontrolle gekennzeichnet und werden im<br />
dem Phänomen ‚paßt‘ und zu einer besseren Kommunizier- und Analysierbarkeit beiträgt“ (EBERL 1996, 105;<br />
zur funktionellen Analogie zwischen individuellem und ‚organisationalem‘ Lernen vgl. a.a.O., 106ff.).<br />
27 Außerdem ist davon auszugehen, daß i.d.R. auch innerhalb der Mitarbeiterschaft bzw. des Management<br />
durchaus verschiedenartige Ziele und Erwartungen existieren.<br />
28 Zur ausführlichen Auseinandersetzung mit dieser Frage vgl. WILKESMANN (1999) und EBERL (1996).<br />
29 Eine ausführlichere Darstellung zum Verhältnis von Handlung und Struktur befindet sich in WILKESMANN<br />
1999, 42ff.<br />
26