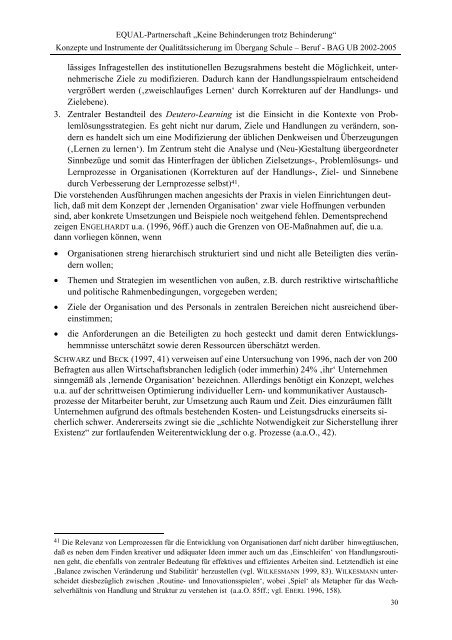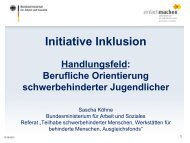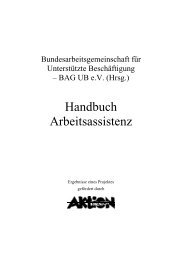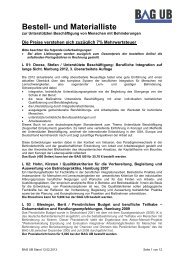Download - BAG UB eV
Download - BAG UB eV
Download - BAG UB eV
- TAGS
- download
- www.bag-ub.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
EQUAL-Partnerschaft „Keine Behinderungen trotz Behinderung“<br />
Konzepte und Instrumente der Qualitätssicherung im Übergang Schule – Beruf - <strong>BAG</strong> <strong>UB</strong> 2002-2005<br />
lässiges Infragestellen des institutionellen Bezugsrahmens besteht die Möglichkeit, unternehmerische<br />
Ziele zu modifizieren. Dadurch kann der Handlungsspielraum entscheidend<br />
vergrößert werden (‚zweischlaufiges Lernen‘ durch Korrekturen auf der Handlungs- und<br />
Zielebene).<br />
3. Zentraler Bestandteil des Deutero-Learning ist die Einsicht in die Kontexte von Problemlösungsstrategien.<br />
Es geht nicht nur darum, Ziele und Handlungen zu verändern, sondern<br />
es handelt sich um eine Modifizierung der üblichen Denkweisen und Überzeugungen<br />
(‚Lernen zu lernen‘). Im Zentrum steht die Analyse und (Neu-)Gestaltung übergeordneter<br />
Sinnbezüge und somit das Hinterfragen der üblichen Zielsetzungs-, Problemlösungs- und<br />
Lernprozesse in Organisationen (Korrekturen auf der Handlungs-, Ziel- und Sinnebene<br />
durch Verbesserung der Lernprozesse selbst) 41 .<br />
Die vorstehenden Ausführungen machen angesichts der Praxis in vielen Einrichtungen deutlich,<br />
daß mit dem Konzept der ‚lernenden Organisation‘ zwar viele Hoffnungen verbunden<br />
sind, aber konkrete Umsetzungen und Beispiele noch weitgehend fehlen. Dementsprechend<br />
zeigen ENGELHARDT u.a. (1996, 96ff.) auch die Grenzen von OE-Maßnahmen auf, die u.a.<br />
dann vorliegen können, wenn<br />
� Organisationen streng hierarchisch strukturiert sind und nicht alle Beteiligten dies verändern<br />
wollen;<br />
� Themen und Strategien im wesentlichen von außen, z.B. durch restriktive wirtschaftliche<br />
und politische Rahmenbedingungen, vorgegeben werden;<br />
� Ziele der Organisation und des Personals in zentralen Bereichen nicht ausreichend übereinstimmen;<br />
� die Anforderungen an die Beteiligten zu hoch gesteckt und damit deren Entwicklungshemmnisse<br />
unterschätzt sowie deren Ressourcen überschätzt werden.<br />
SCHWARZ und BECK (1997, 41) verweisen auf eine Untersuchung von 1996, nach der von 200<br />
Befragten aus allen Wirtschaftsbranchen lediglich (oder immerhin) 24% ‚ihr‘ Unternehmen<br />
sinngemäß als ‚lernende Organisation‘ bezeichnen. Allerdings benötigt ein Konzept, welches<br />
u.a. auf der schrittweisen Optimierung individueller Lern- und kommunikativer Austauschprozesse<br />
der Mitarbeiter beruht, zur Umsetzung auch Raum und Zeit. Dies einzuräumen fällt<br />
Unternehmen aufgrund des oftmals bestehenden Kosten- und Leistungsdrucks einerseits sicherlich<br />
schwer. Andererseits zwingt sie die „schlichte Notwendigkeit zur Sicherstellung ihrer<br />
Existenz“ zur fortlaufenden Weiterentwicklung der o.g. Prozesse (a.a.O., 42).<br />
41 Die Relevanz von Lernprozessen für die Entwicklung von Organisationen darf nicht darüber hinwegtäuschen,<br />
daß es neben dem Finden kreativer und adäquater Ideen immer auch um das ‚Einschleifen‘ von Handlungsroutinen<br />
geht, die ebenfalls von zentraler Bedeutung für effektives und effizientes Arbeiten sind. Letztendlich ist eine<br />
‚Balance zwischen Veränderung und Stabilität‘ herzustellen (vgl. WILKESMANN 1999, 83). WILKESMANN unterscheidet<br />
diesbezüglich zwischen ‚Routine- und Innovationsspielen‘, wobei ‚Spiel‘ als Metapher für das Wechselverhältnis<br />
von Handlung und Struktur zu verstehen ist (a.a.O. 85ff.; vgl. EBERL 1996, 158).<br />
30