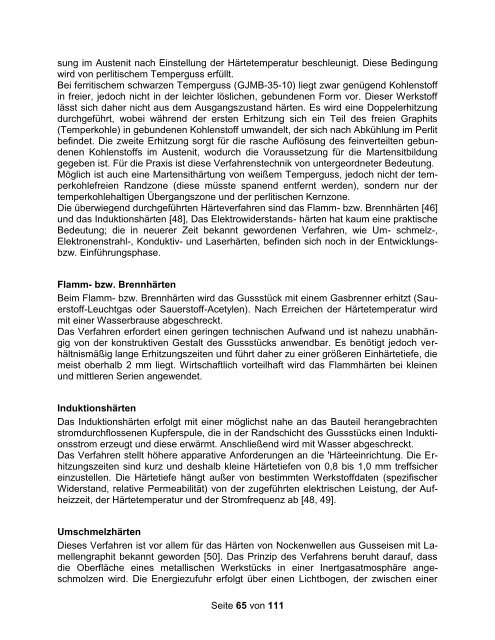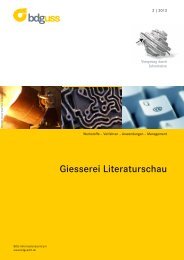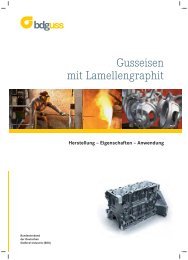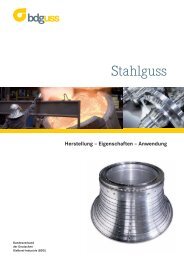kostenfreier Download - Konstruieren und Gießen
kostenfreier Download - Konstruieren und Gießen
kostenfreier Download - Konstruieren und Gießen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sung im Austenit nach Einstellung der Härtetemperatur beschleunigt. Diese Bedingung<br />
wird von perlitischem Temperguss erfüllt.<br />
Bei ferritischem schwarzen Temperguss (GJMB-35-10) liegt zwar genügend Kohlenstoff<br />
in freier, jedoch nicht in der leichter löslichen, geb<strong>und</strong>enen Form vor. Dieser Werkstoff<br />
lässt sich daher nicht aus dem Ausgangszustand härten. Es wird eine Doppelerhitzung<br />
durchgeführt, wobei während der ersten Erhitzung sich ein Teil des freien Graphits<br />
(Temperkohle) in geb<strong>und</strong>enen Kohlenstoff umwandelt, der sich nach Abkühlung im Perlit<br />
befindet. Die zweite Erhitzung sorgt für die rasche Auflösung des feinverteilten geb<strong>und</strong>enen<br />
Kohlenstoffs im Austenit, wodurch die Voraussetzung für die Martensitbildung<br />
gegeben ist. Für die Praxis ist diese Verfahrenstechnik von untergeordneter Bedeutung.<br />
Möglich ist auch eine Martensithärtung von weißem Temperguss, jedoch nicht der temperkohlefreien<br />
Randzone (diese müsste spanend entfernt werden), sondern nur der<br />
temperkohlehaltigen Übergangszone <strong>und</strong> der perlitischen Kernzone.<br />
Die überwiegend durchgeführten Härteverfahren sind das Flamm- bzw. Brennhärten [46]<br />
<strong>und</strong> das Induktionshärten [48], Das Elektrowiderstands- härten hat kaum eine praktische<br />
Bedeutung; die in neuerer Zeit bekannt gewordenen Verfahren, wie Um- schmelz-,<br />
Elektronenstrahl-, Konduktiv- <strong>und</strong> Laserhärten, befinden sich noch in der Entwicklungs-<br />
bzw. Einführungsphase.<br />
Flamm- bzw. Brennhärten<br />
Beim Flamm- bzw. Brennhärten wird das Gussstück mit einem Gasbrenner erhitzt (Sauerstoff-Leuchtgas<br />
oder Sauerstoff-Acetylen). Nach Erreichen der Härtetemperatur wird<br />
mit einer Wasserbrause abgeschreckt.<br />
Das Verfahren erfordert einen geringen technischen Aufwand <strong>und</strong> ist nahezu unabhängig<br />
von der konstruktiven Gestalt des Gussstücks anwendbar. Es benötigt jedoch verhältnismäßig<br />
lange Erhitzungszeiten <strong>und</strong> führt daher zu einer größeren Einhärtetiefe, die<br />
meist oberhalb 2 mm liegt. Wirtschaftlich vorteilhaft wird das Flammhärten bei kleinen<br />
<strong>und</strong> mittleren Serien angewendet.<br />
Induktionshärten<br />
Das Induktionshärten erfolgt mit einer möglichst nahe an das Bauteil herangebrachten<br />
stromdurchflossenen Kupferspule, die in der Randschicht des Gussstücks einen Induktionsstrom<br />
erzeugt <strong>und</strong> diese erwärmt. Anschließend wird mit Wasser abgeschreckt.<br />
Das Verfahren stellt höhere apparative Anforderungen an die 'Härteeinrichtung. Die Erhitzungszeiten<br />
sind kurz <strong>und</strong> deshalb kleine Härtetiefen von 0,8 bis 1,0 mm treffsicher<br />
einzustellen. Die Härtetiefe hängt außer von bestimmten Werkstoffdaten (spezifischer<br />
Widerstand, relative Permeabilität) von der zugeführten elektrischen Leistung, der Aufheizzeit,<br />
der Härtetemperatur <strong>und</strong> der Stromfrequenz ab [48, 49].<br />
Umschmelzhärten<br />
Dieses Verfahren ist vor allem für das Härten von Nockenwellen aus Gusseisen mit Lamellengraphit<br />
bekannt geworden [50]. Das Prinzip des Verfahrens beruht darauf, dass<br />
die Oberfläche eines metallischen Werkstücks in einer Inertgasatmosphäre angeschmolzen<br />
wird. Die Energiezufuhr erfolgt über einen Lichtbogen, der zwischen einer<br />
Seite 65 von 111