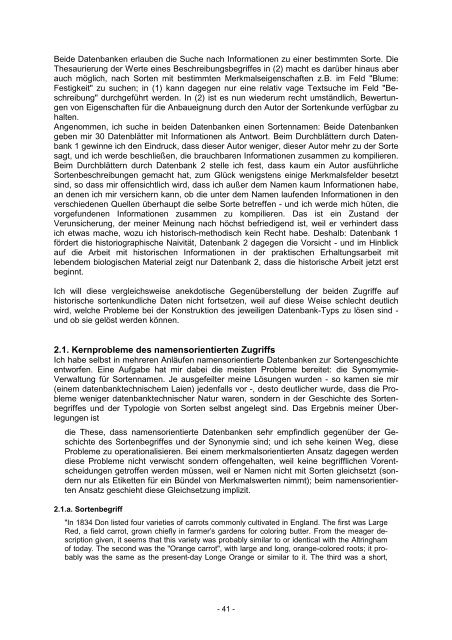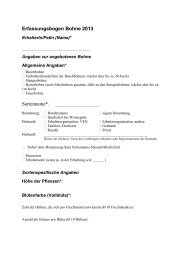Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Beide Datenbanken erlauben die Suche nach Informationen zu einer bestimmten Sorte. Die<br />
Thesaurierung <strong>der</strong> Werte eines Beschreibungsbegriffes in (2) macht es darüber hinaus aber<br />
auch möglich, nach Sorten mit bestimmten Merkmalseigenschaften z.B. im Feld "Blume:<br />
Festigkeit" zu suchen; in (1) kann dagegen nur eine relativ vage Textsuche im Feld "Beschreibung"<br />
durchgeführt werden. In (2) ist es nun wie<strong>der</strong>um recht umständlich, Bewertungen<br />
von Eigenschaften für die Anbaueignung durch den Autor <strong>der</strong> Sortenkunde verfügbar zu<br />
halten.<br />
Angenommen, ich suche in beiden Datenbanken einen Sortennamen: Beide Datenbanken<br />
geben mir 30 Datenblätter mit Informationen als Antwort. Beim Durchblättern durch Datenbank<br />
1 gewinne ich den Eindruck, dass dieser Autor weniger, dieser Autor mehr zu <strong>der</strong> Sorte<br />
sagt, und ich werde beschließen, die brauchbaren Informationen zusammen zu kompilieren.<br />
Beim Durchblättern durch Datenbank 2 stelle ich fest, dass kaum ein Autor ausführliche<br />
Sortenbeschreibungen gemacht hat, zum Glück wenigstens einige Merkmalsfel<strong>der</strong> besetzt<br />
sind, so dass mir offensichtlich wird, dass ich außer dem Namen kaum Informationen habe,<br />
an denen ich mir versichern kann, ob die unter dem Namen laufenden Informationen in den<br />
verschiedenen Quellen überhaupt die selbe Sorte betreffen - und ich werde mich hüten, die<br />
vorgefundenen Informationen zusammen zu kompilieren. Das ist ein Zustand <strong>der</strong><br />
Verunsicherung, <strong>der</strong> meiner Meinung nach höchst befriedigend ist, weil er verhin<strong>der</strong>t dass<br />
ich etwas mache, wozu ich historisch-methodisch kein Recht habe. Deshalb: Datenbank 1<br />
för<strong>der</strong>t die historiographische Naivität, Datenbank 2 dagegen die Vorsicht - und im Hinblick<br />
auf die Arbeit mit historischen Informationen in <strong>der</strong> praktischen <strong>Erhaltung</strong>sarbeit mit<br />
lebendem biologischen Material zeigt nur Datenbank 2, dass die historische Arbeit jetzt erst<br />
beginnt.<br />
Ich will diese vergleichsweise anekdotische Gegenüberstellung <strong>der</strong> beiden Zugriffe auf<br />
historische sortenkundliche Daten nicht fortsetzen, weil auf diese Weise schlecht deutlich<br />
wird, welche Probleme bei <strong>der</strong> Konstruktion des jeweiligen Datenbank-Typs zu lösen sind -<br />
und ob sie gelöst werden können.<br />
2.1. Kernprobleme des namensorientierten Zugriffs<br />
Ich habe selbst in mehreren Anläufen namensorientierte Datenbanken <strong>zur</strong> Sortengeschichte<br />
entworfen. Eine Aufgabe hat mir dabei die meisten Probleme bereitet: die Synomymie-<br />
Verwaltung für Sortennamen. Je ausgefeilter meine Lösungen wurden - so kamen sie mir<br />
(einem datenbanktechnischem Laien) jedenfalls vor -, desto deutlicher wurde, dass die Probleme<br />
weniger datenbanktechnischer Natur waren, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Geschichte des Sortenbegriffes<br />
und <strong>der</strong> Typologie von Sorten selbst angelegt sind. Das Ergebnis meiner Überlegungen<br />
ist<br />
die These, dass namensorientierte Datenbanken sehr empfindlich gegenüber <strong>der</strong> Geschichte<br />
des Sortenbegriffes und <strong>der</strong> Synonymie sind; und ich sehe keinen Weg, diese<br />
Probleme zu operationalisieren. Bei einem merkmalsorientierten Ansatz dagegen werden<br />
diese Probleme nicht verwischt son<strong>der</strong>n offengehalten, weil keine begrifflichen Vorentscheidungen<br />
getroffen werden müssen, weil er Namen nicht mit Sorten gleichsetzt (son<strong>der</strong>n<br />
nur als Etiketten für ein Bündel von Merkmalswerten nimmt); beim namensorientierten<br />
Ansatz geschieht diese Gleichsetzung implizit.<br />
2.1.a. Sortenbegriff<br />
"In 1834 Don listed four varieties of carrots commonly cultivated in England. The first was Large<br />
Red, a field carrot, grown chiefly in farmer’s gardens for coloring butter. From the meager description<br />
given, it seems that this variety was probably similar to or identical with the Altringham<br />
of today. The second was the "Orange carrot", with large and long, orange-colored roots; it probably<br />
was the same as the present-day Longe Orange or similar to it. The third was a short,<br />
- 41 -