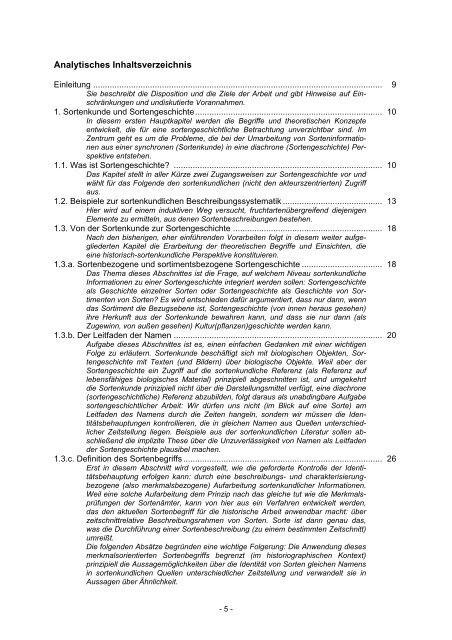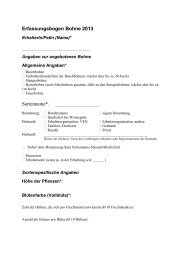Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Analytisches Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung .......................................................................................................................... 9<br />
Sie beschreibt die Disposition und die Ziele <strong>der</strong> Arbeit und gibt Hinweise auf Einschränkungen<br />
und undiskutierte Vorannahmen.<br />
1. Sortenkunde und Sortengeschichte............................................................................... 10<br />
In diesem ersten Hauptkapitel werden die Begriffe und theoretischen Konzepte<br />
entwickelt, die für eine sortengeschichtliche Betrachtung unverzichtbar sind. Im<br />
Zentrum geht es um die Probleme, die bei <strong>der</strong> Umarbeitung von Sorteninformationen<br />
aus einer synchronen (Sortenkunde) in eine diachrone (Sortengeschichte) Perspektive<br />
entstehen.<br />
1.1. Was ist Sortengeschichte? ........................................................................................ 10<br />
Das Kapitel stellt in aller Kürze zwei Zugangsweisen <strong>zur</strong> Sortengeschichte vor und<br />
wählt für das Folgende den sortenkundlichen (nicht den akteurszentrierten) Zugriff<br />
aus.<br />
1.2. Beispiele <strong>zur</strong> sortenkundlichen Beschreibungssystematik .......................................... 13<br />
Hier wird auf einem induktiven Weg versucht, fruchtartenübergreifend diejenigen<br />
Elemente zu ermitteln, aus denen Sortenbeschreibungen bestehen.<br />
1.3. Von <strong>der</strong> Sortenkunde <strong>zur</strong> Sortengeschichte ............................................................... 18<br />
Nach den bisherigen, eher einführenden Vorarbeiten folgt in diesem weiter aufgeglie<strong>der</strong>ten<br />
Kapitel die Erarbeitung <strong>der</strong> theoretischen Begriffe und Einsichten, die<br />
eine historisch-sortenkundliche Perspektive konstituieren.<br />
1.3.a. Sortenbezogene und sortimentsbezogene Sortengeschichte .................................. 18<br />
Das Thema dieses Abschnittes ist die Frage, auf welchem Niveau sortenkundliche<br />
Informationen zu einer Sortengeschichte integriert werden sollen: Sortengeschichte<br />
als Geschichte einzelner Sorten o<strong>der</strong> Sortengeschichte als Geschichte von Sortimenten<br />
von Sorten? Es wird entschieden dafür argumentiert, dass nur dann, wenn<br />
das Sortiment die Bezugsebene ist, Sortengeschichte (von innen heraus gesehen)<br />
ihre Herkunft aus <strong>der</strong> Sortenkunde bewahren kann, und dass sie nur dann (als<br />
Zugewinn, von außen gesehen) Kultur(pflanzen)geschichte werden kann.<br />
1.3.b. Der Leitfaden <strong>der</strong> Namen ........................................................................................ 20<br />
Aufgabe dieses Abschnittes ist es, einen einfachen Gedanken mit einer wichtigen<br />
Folge zu erläutern. Sortenkunde beschäftigt sich mit biologischen Objekten, Sortengeschichte<br />
mit Texten (und Bil<strong>der</strong>n) über biologische Objekte. Weil aber <strong>der</strong><br />
Sortengeschichte ein Zugriff auf die sortenkundliche Referenz (als Referenz auf<br />
lebensfähiges biologisches Material) prinzipiell abgeschnitten ist, und umgekehrt<br />
die Sortenkunde prinzipiell nicht über die Darstellungsmittel verfügt, eine diachrone<br />
(sortengeschichtliche) Referenz abzubilden, folgt daraus als unabdingbare Aufgabe<br />
sortengeschichtlicher Arbeit: Wir dürfen uns nicht (im Blick auf eine Sorte) am<br />
Leitfaden des Namens durch die Zeiten hangeln, son<strong>der</strong>n wir müssen die Identitätsbehauptungen<br />
kontrollieren, die in gleichen Namen aus Quellen unterschiedlicher<br />
Zeitstellung liegen. Beispiele aus <strong>der</strong> sortenkundlichen Literatur sollen abschließend<br />
die implizite These über die Unzuverlässigkeit von Namen als Leitfaden<br />
<strong>der</strong> Sortengeschichte plausibel machen.<br />
1.3.c. Definition des Sortenbegriffs .................................................................................... 26<br />
Erst in diesem Abschnitt wird vorgestellt, wie die gefor<strong>der</strong>te Kontrolle <strong>der</strong> Identitätsbehauptung<br />
erfolgen kann: durch eine beschreibungs- und charakterisierungbezogene<br />
(also merkmalsbezogene) Aufarbeitung sortenkundlicher Informationen.<br />
Weil eine solche Aufarbeitung dem Prinzip nach das gleiche tut wie die Merkmalsprüfungen<br />
<strong>der</strong> Sortenämter, kann von hier aus ein Verfahren entwickelt werden,<br />
das den aktuellen Sortenbegriff für die historische Arbeit anwendbar macht: über<br />
zeitschnittrelative Beschreibungsrahmen von Sorten. Sorte ist dann genau das,<br />
was die Durchführung einer Sortenbeschreibung (zu einem bestimmten Zeitschnitt)<br />
umreißt.<br />
Die folgenden Absätze begründen eine wichtige Folgerung: Die Anwendung dieses<br />
merkmalsorientierten Sortenbegriffs begrenzt (im historiographischen Kontext)<br />
prinzipiell die Aussagemöglichkeiten über die Identität von Sorten gleichen Namens<br />
in sortenkundlichen Quellen unterschiedlicher Zeitstellung und verwandelt sie in<br />
Aussagen über Ähnlichkeit.<br />
- 5 -