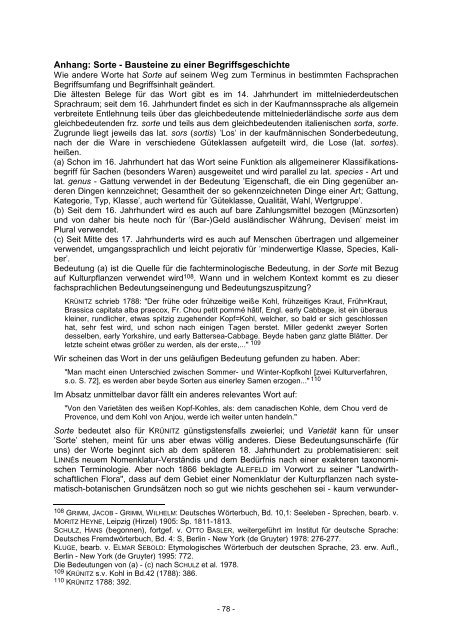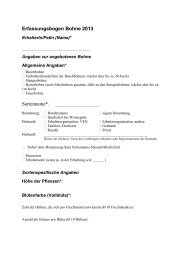Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anhang: Sorte - Bausteine zu einer Begriffsgeschichte<br />
Wie an<strong>der</strong>e Worte hat Sorte auf seinem Weg zum Terminus in bestimmten Fachsprachen<br />
Begriffsumfang und Begriffsinhalt geän<strong>der</strong>t.<br />
Die ältesten Belege für das Wort gibt es im 14. Jahrhun<strong>der</strong>t im mittelnie<strong>der</strong>deutschen<br />
Sprachraum; seit dem 16. Jahrhun<strong>der</strong>t findet es sich in <strong>der</strong> Kaufmannssprache als allgemein<br />
verbreitete Entlehnung teils über das gleichbedeutende mittelnie<strong>der</strong>ländische sorte aus dem<br />
gleichbedeutenden frz. sorte und teils aus dem gleichbedeutenden italienischen sorta, sorte.<br />
Zugrunde liegt jeweils das lat. sors (sortis) ’Los’ in <strong>der</strong> kaufmännischen Son<strong>der</strong>bedeutung,<br />
nach <strong>der</strong> die Ware in verschiedene Güteklassen aufgeteilt wird, die Lose (lat. sortes).<br />
heißen.<br />
(a) Schon im 16. Jahrhun<strong>der</strong>t hat das Wort seine Funktion als allgemeinerer Klassifikationsbegriff<br />
für Sachen (beson<strong>der</strong>s Waren) ausgeweitet und wird parallel zu lat. species - Art und<br />
lat. genus - Gattung verwendet in <strong>der</strong> Bedeutung ’Eigenschaft, die ein Ding gegenüber an<strong>der</strong>en<br />
Dingen kennzeichnet; Gesamtheit <strong>der</strong> so gekennzeichneten Dinge einer Art; Gattung,<br />
Kategorie, Typ, Klasse’, auch wertend für ’Güteklasse, Qualität, Wahl, Wertgruppe’.<br />
(b) Seit dem 16. Jahrhun<strong>der</strong>t wird es auch auf bare Zahlungsmittel bezogen (Münzsorten)<br />
und von daher bis heute noch für ’(Bar-)Geld ausländischer Währung, Devisen’ meist im<br />
Plural verwendet.<br />
(c) Seit Mitte des 17. Jahrhun<strong>der</strong>ts wird es auch auf Menschen übertragen und allgemeiner<br />
verwendet, umgangssprachlich und leicht pejorativ für ’min<strong>der</strong>wertige Klasse, Species, Kaliber’.<br />
Bedeutung (a) ist die Quelle für die fachterminologische Bedeutung, in <strong>der</strong> Sorte mit Bezug<br />
auf Kulturpflanzen verwendet wird 108 . Wann und in welchem Kontext kommt es zu dieser<br />
fachsprachlichen Bedeutungseinengung und Bedeutungszuspitzung?<br />
KRÜNITZ schrieb 1788: "Der frühe o<strong>der</strong> frühzeitige weiße Kohl, frühzeitiges Kraut, Früh=Kraut,<br />
Brassica capitata alba praecox, Fr. Chou petit pommé hâtif, Engl. early Cabbage, ist ein überaus<br />
kleiner, rundlicher, etwas spitzig zugehen<strong>der</strong> Kopf=Kohl, welcher, so bald er sich geschlossen<br />
hat, sehr fest wird, und schon nach einigen Tagen berstet. Miller gedenkt zweyer Sorten<br />
desselben, early Yorkshire, und early Battersea-Cabbage. Beyde haben ganz glatte Blätter. Der<br />
letzte scheint etwas größer zu werden, als <strong>der</strong> erste,..." 109<br />
Wir scheinen das Wort in <strong>der</strong> uns geläufigen Bedeutung gefunden zu haben. Aber:<br />
"Man macht einen Unterschied zwischen Sommer- und Winter-Kopfkohl [zwei Kulturverfahren,<br />
s.o. S. 72], es werden aber beyde Sorten aus einerley Samen erzogen..." 110<br />
Im Absatz unmittelbar davor fällt ein an<strong>der</strong>es relevantes Wort auf:<br />
"Von den Varietäten des weißen Kopf-Kohles, als: dem canadischen Kohle, dem Chou verd de<br />
Provence, und dem Kohl von Anjou, werde ich weiter unten handeln."<br />
Sorte bedeutet also für KRÜNITZ günstigstensfalls zweierlei; und Varietät kann für unser<br />
’Sorte’ stehen, meint für uns aber etwas völlig an<strong>der</strong>es. Diese Bedeutungsunschärfe (für<br />
uns) <strong>der</strong> Worte beginnt sich ab dem späteren 18. Jahrhun<strong>der</strong>t zu problematisieren: seit<br />
LINNÉs neuem Nomenklatur-Verständis und dem Bedürfnis nach einer exakteren taxonomischen<br />
Terminologie. Aber noch 1866 beklagte ALEFELD im Vorwort zu seiner "Landwirthschaftlichen<br />
Flora", dass auf dem Gebiet einer Nomenklatur <strong>der</strong> Kulturpflanzen nach systematisch-botanischen<br />
Grundsätzen noch so gut wie nichts geschehen sei - kaum verwun<strong>der</strong>-<br />
108 GRIMM, JACOB - GRIMM, WILHELM: Deutsches Wörterbuch, Bd. 10,1: Seeleben - Sprechen, bearb. v.<br />
MORITZ HEYNE, Leipzig (Hirzel) 1905: Sp. 1811-1813.<br />
SCHULZ, HANS (begonnen), fortgef. v. OTTO BASLER, weitergeführt im Institut für deutsche Sprache:<br />
Deutsches Fremdwörterbuch, Bd. 4: S, Berlin - New York (de Gruyter) 1978: 276-277.<br />
KLUGE, bearb. v. ELMAR SEBOLD: Etymologisches Wörterbuch <strong>der</strong> deutschen Sprache, 23. erw. Aufl.,<br />
Berlin - New York (de Gruyter) 1995: 772.<br />
Die Bedeutungen von (a) - (c) nach SCHULZ et al. 1978.<br />
109 KRÜNITZ s.v. Kohl in Bd.42 (1788): 386.<br />
110 KRÜNITZ 1788: 392.<br />
- 78 -