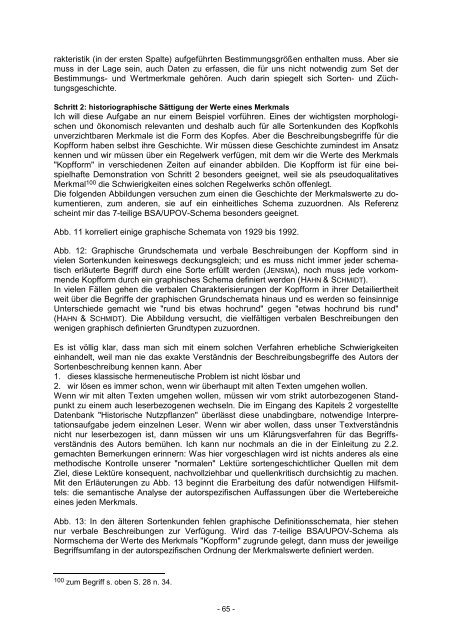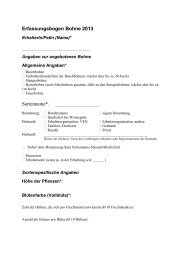Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
akteristik (in <strong>der</strong> ersten Spalte) aufgeführten Bestimmungsgrößen enthalten muss. Aber sie<br />
muss in <strong>der</strong> Lage sein, auch Daten zu erfassen, die für uns nicht notwendig zum Set <strong>der</strong><br />
Bestimmungs- und Wertmerkmale gehören. Auch darin spiegelt sich Sorten- und Züchtungsgeschichte.<br />
Schritt 2: historiographische Sättigung <strong>der</strong> Werte eines Merkmals<br />
Ich will diese Aufgabe an nur einem Beispiel vorführen. Eines <strong>der</strong> wichtigsten morphologischen<br />
und ökonomisch relevanten und deshalb auch für alle Sortenkunden des Kopfkohls<br />
unverzichtbaren Merkmale ist die Form des Kopfes. Aber die Beschreibungsbegriffe für die<br />
Kopfform haben selbst ihre Geschichte. Wir müssen diese Geschichte zumindest im Ansatz<br />
kennen und wir müssen über ein Regelwerk verfügen, mit dem wir die Werte des Merkmals<br />
"Kopfform" in verschiedenen Zeiten auf einan<strong>der</strong> abbilden. Die Kopfform ist für eine beispielhafte<br />
Demonstration von Schritt 2 beson<strong>der</strong>s geeignet, weil sie als pseudoqualitatives<br />
Merkmal 100 die Schwierigkeiten eines solchen Regelwerks schön offenlegt.<br />
Die folgenden Abbildungen versuchen zum einen die Geschichte <strong>der</strong> Merkmalswerte zu dokumentieren,<br />
zum an<strong>der</strong>en, sie auf ein einheitliches Schema zuzuordnen. Als Referenz<br />
scheint mir das 7-teilige BSA/UPOV-Schema beson<strong>der</strong>s geeignet.<br />
Abb. 11 korreliert einige graphische Schemata von 1929 bis 1992.<br />
Abb. 12: Graphische Grundschemata und verbale Beschreibungen <strong>der</strong> Kopfform sind in<br />
vielen Sortenkunden keineswegs deckungsgleich; und es muss nicht immer je<strong>der</strong> schematisch<br />
erläuterte Begriff durch eine Sorte erfüllt werden (JENSMA), noch muss jede vorkommende<br />
Kopfform durch ein graphisches Schema definiert werden (HAHN & SCHMIDT).<br />
In vielen Fällen gehen die verbalen Charakterisierungen <strong>der</strong> Kopfform in ihrer Detailiertheit<br />
weit über die Begriffe <strong>der</strong> graphischen Grundschemata hinaus und es werden so feinsinnige<br />
Unterschiede gemacht wie "rund bis etwas hochrund" gegen "etwas hochrund bis rund"<br />
(HAHN & SCHMIDT). Die Abbildung versucht, die vielfältigen verbalen Beschreibungen den<br />
wenigen graphisch definierten Grundtypen zuzuordnen.<br />
Es ist völlig klar, dass man sich mit einem solchen Verfahren erhebliche Schwierigkeiten<br />
einhandelt, weil man nie das exakte Verständnis <strong>der</strong> Beschreibungsbegriffe des Autors <strong>der</strong><br />
Sortenbeschreibung kennen kann. Aber<br />
1. dieses klassische hermeneutische Problem ist nicht lösbar und<br />
2. wir lösen es immer schon, wenn wir überhaupt mit alten Texten umgehen wollen.<br />
Wenn wir mit alten Texten umgehen wollen, müssen wir vom strikt autorbezogenen Standpunkt<br />
zu einem auch leserbezogenen wechseln. Die im Eingang des Kapitels 2 vorgestellte<br />
Datenbank "Historische Nutzpflanzen" überlässt diese unabdingbare, notwendige Interpretationsaufgabe<br />
jedem einzelnen Leser. Wenn wir aber wollen, dass unser Textverständnis<br />
nicht nur leserbezogen ist, dann müssen wir uns um Klärungsverfahren für das Begriffsverständnis<br />
des Autors bemühen. Ich kann nur nochmals an die in <strong>der</strong> Einleitung zu 2.2.<br />
gemachten Bemerkungen erinnern: Was hier vorgeschlagen wird ist nichts an<strong>der</strong>es als eine<br />
methodische Kontrolle unserer "normalen" Lektüre sortengeschichtlicher Quellen mit dem<br />
Ziel, diese Lektüre konsequent, nachvollziehbar und quellenkritisch durchsichtig zu machen.<br />
Mit den Erläuterungen zu Abb. 13 beginnt die Erarbeitung des dafür notwendigen Hilfsmittels:<br />
die semantische Analyse <strong>der</strong> autorspezifischen Auffassungen über die Wertebereiche<br />
eines jeden Merkmals.<br />
Abb. 13: In den älteren Sortenkunden fehlen graphische Definitionsschemata, hier stehen<br />
nur verbale Beschreibungen <strong>zur</strong> Verfügung. Wird das 7-teilige BSA/UPOV-Schema als<br />
Normschema <strong>der</strong> Werte des Merkmals "Kopfform" zugrunde gelegt, dann muss <strong>der</strong> jeweilige<br />
Begriffsumfang in <strong>der</strong> autorspezifischen Ordnung <strong>der</strong> Merkmalswerte definiert werden.<br />
100 zum Begriff s. oben S. 28 n. 34.<br />
- 65 -