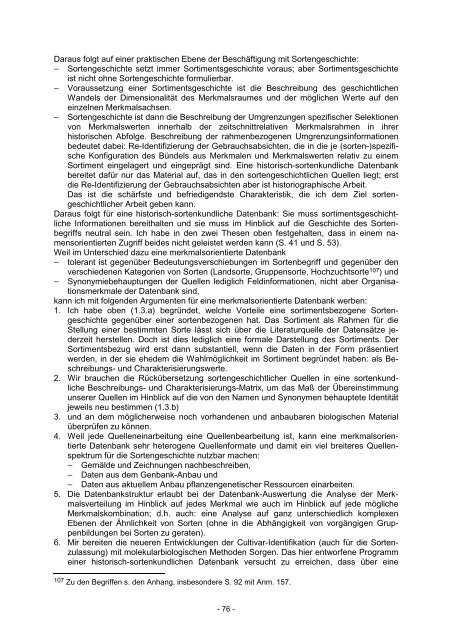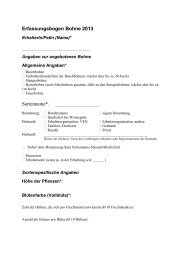Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Daraus folgt auf einer praktischen Ebene <strong>der</strong> Beschäftigung mit Sortengeschichte:<br />
− Sortengeschichte setzt immer Sortimentsgeschichte voraus; aber Sortimentsgeschichte<br />
ist nicht ohne Sortengeschichte formulierbar.<br />
− Voraussetzung einer Sortimentsgeschichte ist die Beschreibung des geschichtlichen<br />
Wandels <strong>der</strong> Dimensionalität des Merkmalsraumes und <strong>der</strong> möglichen Werte auf den<br />
einzelnen Merkmalsachsen.<br />
− Sortengeschichte ist dann die Beschreibung <strong>der</strong> Umgrenzungen spezifischer Selektionen<br />
von Merkmalswerten innerhalb <strong>der</strong> zeitschnittrelativen Merkmalsrahmen in ihrer<br />
historischen Abfolge. Beschreibung <strong>der</strong> rahmenbezogenen Umgrenzungsinformationen<br />
bedeutet dabei: Re-Identifizierung <strong>der</strong> Gebrauchsabsichten, die in die je (sorten-)spezifische<br />
Konfiguration des Bündels aus Merkmalen und Merkmalswerten relativ zu einem<br />
Sortiment eingelagert und eingeprägt sind. Eine historisch-sortenkundliche Datenbank<br />
bereitet dafür nur das Material auf, das in den sortengeschichtlichen Quellen liegt; erst<br />
die Re-Identifizierung <strong>der</strong> Gebrauchsabsichten aber ist historiographische Arbeit.<br />
Das ist die schärfste und befriedigendste Charakteristik, die ich dem Ziel sortengeschichtlicher<br />
Arbeit geben kann.<br />
Daraus folgt für eine historisch-sortenkundliche Datenbank: Sie muss sortimentsgeschichtliche<br />
Informationen bereithalten und sie muss im Hinblick auf die Geschichte des Sortenbegriffs<br />
neutral sein. Ich habe in den zwei Thesen oben festgehalten, dass in einem namensorientierten<br />
Zugriff beides nicht geleistet werden kann (S. 41 und S. 53).<br />
Weil im Unterschied dazu eine merkmalsorientierte Datenbank<br />
− tolerant ist gegenüber Bedeutungsverschiebungen im Sortenbegriff und gegenüber den<br />
verschiedenen Kategorien von Sorten (Landsorte, Gruppensorte, Hochzuchtsorte 107 ) und<br />
− Synonymiebehauptungen <strong>der</strong> Quellen lediglich Feldinformationen, nicht aber Organisationsmerkmale<br />
<strong>der</strong> Datenbank sind,<br />
kann ich mit folgenden Argumenten für eine merkmalsorientierte Datenbank werben:<br />
1. Ich habe oben (1.3.a) begründet, welche Vorteile eine sortimentsbezogene Sortengeschichte<br />
gegenüber einer sortenbezogenen hat. Das Sortiment als Rahmen für die<br />
Stellung einer bestimmten Sorte lässt sich über die Literaturquelle <strong>der</strong> Datensätze je<strong>der</strong>zeit<br />
herstellen. Doch ist dies lediglich eine formale Darstellung des Sortiments. Der<br />
Sortimentsbezug wird erst dann substantiell, wenn die Daten in <strong>der</strong> Form präsentiert<br />
werden, in <strong>der</strong> sie ehedem die Wahlmöglichkeit im Sortiment begründet haben: als Beschreibungs-<br />
und Charakterisierungswerte.<br />
2. Wir brauchen die Rückübersetzung sortengeschichtlicher Quellen in eine sortenkundliche<br />
Beschreibungs- und Charakterisierungs-Matrix, um das Maß <strong>der</strong> Übereinstimmung<br />
unserer Quellen im Hinblick auf die von den Namen und Synonymen behauptete Identität<br />
jeweils neu bestimmen (1.3.b)<br />
3. und an dem möglicherweise noch vorhandenen und anbaubaren biologischen Material<br />
überprüfen zu können.<br />
4. Weil jede Quelleneinarbeitung eine Quellenbearbeitung ist, kann eine merkmalsorientierte<br />
Datenbank sehr heterogene Quellenformate und damit ein viel breiteres Quellenspektrum<br />
für die Sortengeschichte nutzbar machen:<br />
− Gemälde und Zeichnungen nachbeschreiben,<br />
− Daten aus dem Genbank-Anbau und<br />
− Daten aus aktuellem Anbau pflanzengenetischer Ressourcen einarbeiten.<br />
5. Die Datenbankstruktur erlaubt bei <strong>der</strong> Datenbank-Auswertung die Analyse <strong>der</strong> Merkmalsverteilung<br />
im Hinblick auf jedes Merkmal wie auch im Hinblick auf jede mögliche<br />
Merkmalskombination; d.h. auch: eine Analyse auf ganz unterschiedlich komplexen<br />
Ebenen <strong>der</strong> Ähnlichkeit von Sorten (ohne in die Abhängigkeit von vorgängigen Gruppenbildungen<br />
bei Sorten zu geraten).<br />
6. Mir bereiten die neueren Entwicklungen <strong>der</strong> Cultivar-Identifikation (auch für die Sortenzulassung)<br />
mit molekularbiologischen Methoden Sorgen. Das hier entworfene Programm<br />
einer historisch-sortenkundlichen Datenbank versucht zu erreichen, dass über eine<br />
107 Zu den Begriffen s. den Anhang, insbeson<strong>der</strong>e S. 92 mit Anm. 157.<br />
- 76 -