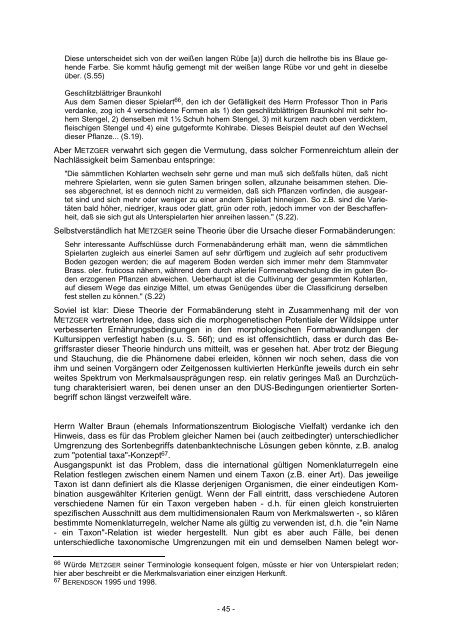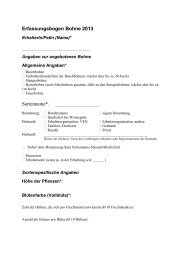Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diese unterscheidet sich von <strong>der</strong> weißen langen Rübe [a)] durch die hellrothe bis ins Blaue gehende<br />
Farbe. Sie kommt häufig gemengt mit <strong>der</strong> weißen lange Rübe vor und geht in dieselbe<br />
über. (S.55)<br />
Geschlitzblättriger Braunkohl<br />
Aus dem Samen dieser Spielart 66 , den ich <strong>der</strong> Gefälligkeit des Herrn Professor Thon in Paris<br />
verdanke, zog ich 4 verschiedene Formen als 1) den geschlitzblättrigen Braunkohl mit sehr hohem<br />
Stengel, 2) denselben mit 1½ Schuh hohem Stengel, 3) mit kurzem nach oben verdicktem,<br />
fleischigen Stengel und 4) eine gutgeformte Kohlrabe. Dieses Beispiel deutet auf den Wechsel<br />
dieser Pflanze... (S.19).<br />
Aber METZGER verwahrt sich gegen die Vermutung, dass solcher Formenreichtum allein <strong>der</strong><br />
Nachlässigkeit beim Samenbau entspringe:<br />
"Die sämmtlichen Kohlarten wechseln sehr gerne und man muß sich deßfalls hüten, daß nicht<br />
mehrere Spielarten, wenn sie guten Samen bringen sollen, allzunahe beisammen stehen. Dieses<br />
abgerechnet, ist es dennoch nicht zu vermeiden, daß sich Pflanzen vorfinden, die ausgeartet<br />
sind und sich mehr o<strong>der</strong> weniger zu einer an<strong>der</strong>n Spielart hinneigen. So z.B. sind die Varietäten<br />
bald höher, niedriger, kraus o<strong>der</strong> glatt, grün o<strong>der</strong> roth, jedoch immer von <strong>der</strong> Beschaffenheit,<br />
daß sie sich gut als Unterspielarten hier anreihen lassen." (S.22).<br />
Selbstverständlich hat METZGER seine Theorie über die Ursache dieser Formabän<strong>der</strong>ungen:<br />
Sehr interessante Auffschlüsse durch Formenabän<strong>der</strong>ung erhält man, wenn die sämmtlichen<br />
Spielarten zugleich aus einerlei Samen auf sehr dürftigem und zugleich auf sehr productivem<br />
Boden gezogen werden; die auf magerem Boden werden sich immer mehr dem Stammvater<br />
Brass. oler. fruticosa nähern, während dem durch allerlei Formenabwechslung die im guten Boden<br />
erzogenen Pflanzen abweichen. Ueberhaupt ist die Cultivirung <strong>der</strong> gesammten Kohlarten,<br />
auf diesem Wege das einzige Mittel, um etwas Genügendes über die Classificirung <strong>der</strong>selben<br />
fest stellen zu können." (S.22)<br />
Soviel ist klar: Diese Theorie <strong>der</strong> Formabän<strong>der</strong>ung steht in Zusammenhang mit <strong>der</strong> von<br />
METZGER vertretenen Idee, dass sich die morphogenetischen Potentiale <strong>der</strong> Wildsippe unter<br />
verbesserten Ernährungsbedingungen in den morphologischen Formabwandlungen <strong>der</strong><br />
Kultursippen verfestigt haben (s.u. S. 56f); und es ist offensichtlich, dass er durch das Begriffsraster<br />
dieser Theorie hindurch uns mitteilt, was er gesehen hat. Aber trotz <strong>der</strong> Biegung<br />
und Stauchung, die die Phänomene dabei erleiden, können wir noch sehen, dass die von<br />
ihm und seinen Vorgängern o<strong>der</strong> Zeitgenossen kultivierten Herkünfte jeweils durch ein sehr<br />
weites Spektrum von Merkmalsausprägungen resp. ein relativ geringes Maß an Durchzüchtung<br />
charakterisiert waren, bei denen unser an den DUS-Bedingungen orientierter Sortenbegriff<br />
schon längst verzweifelt wäre.<br />
Herrn Walter Braun (ehemals Informationszentrum Biologische Vielfalt) verdanke ich den<br />
Hinweis, dass es für das Problem gleicher Namen bei (auch zeitbedingter) unterschiedlicher<br />
Umgrenzung des Sortenbegriffs datenbanktechnische Lösungen geben könnte, z.B. analog<br />
zum "potential taxa"-Konzept 67 .<br />
Ausgangspunkt ist das Problem, dass die international gültigen Nomenklaturregeln eine<br />
Relation festlegen zwischen einem Namen und einem Taxon (z.B. einer Art). Das jeweilige<br />
Taxon ist dann definiert als die Klasse <strong>der</strong>jenigen Organismen, die einer eindeutigen Kombination<br />
ausgewählter Kriterien genügt. Wenn <strong>der</strong> Fall eintritt, dass verschiedene Autoren<br />
verschiedene Namen für ein Taxon vergeben haben - d.h. für einen gleich konstruierten<br />
spezifischen Ausschnitt aus dem multidimensionalen Raum von Merkmalswerten -, so klären<br />
bestimmte Nomenklaturregeln, welcher Name als gültig zu verwenden ist, d.h. die "ein Name<br />
- ein Taxon"-Relation ist wie<strong>der</strong> hergestellt. Nun gibt es aber auch Fälle, bei denen<br />
unterschiedliche taxonomische Umgrenzungen mit ein und demselben Namen belegt wor-<br />
66 Würde METZGER seiner Terminologie konsequent folgen, müsste er hier von Unterspielart reden;<br />
hier aber beschreibt er die Merkmalsvariation einer einzigen Herkunft.<br />
67 BERENDSON 1995 und 1998.<br />
- 45 -