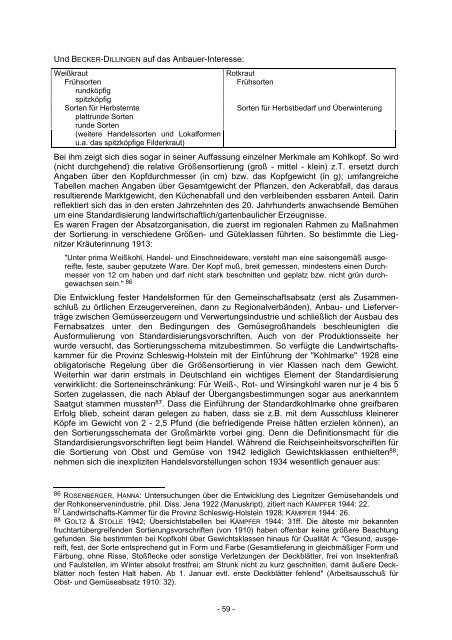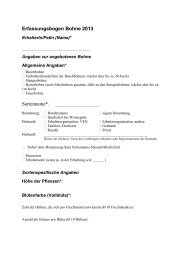Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Download - VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Und BECKER-DILLINGEN auf das Anbauer-Interesse:<br />
Weißkraut Rotkraut<br />
Frühsorten Frühsorten<br />
rundköpfig<br />
spitzköpfig<br />
Sorten für Herbsternte Sorten für Herbstbedarf und Überwinterung<br />
plattrunde Sorten<br />
runde Sorten<br />
(weitere Handelssorten und Lokalformen<br />
u.a. das spitzköpfige Fil<strong>der</strong>kraut)<br />
Bei ihm zeigt sich dies sogar in seiner Auffassung einzelner Merkmale am Kohlkopf. So wird<br />
(nicht durchgehend) die relative Größensortierung (groß - mittel - klein) z.T. ersetzt durch<br />
Angaben über den Kopfdurchmesser (in cm) bzw. das Kopfgewicht (in g); umfangreiche<br />
Tabellen machen Angaben über Gesamtgewicht <strong>der</strong> Pflanzen, den Ackerabfall, das daraus<br />
resultierende Marktgewicht, den Küchenabfall und den verbleibenden essbaren Anteil. Darin<br />
reflektiert sich das in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts anwachsende Bemühen<br />
um eine Standardisierung landwirtschaftlich/gartenbaulicher Erzeugnisse.<br />
Es waren Fragen <strong>der</strong> Absatzorganisation, die zuerst im regionalen Rahmen zu Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> Sortierung in verschiedene Größen- und Güteklassen führten. So bestimmte die Liegnitzer<br />
Kräuterinnung 1913:<br />
"Unter prima Weißkohl, Handel- und Einschneideware, versteht man eine saisongemäß ausgereifte,<br />
feste, sauber geputzete Ware. Der Kopf muß, breit gemessen, mindestens einen Durchmesser<br />
von 12 cm haben und darf nicht stark beschnitten und geplatz bzw. nicht grün durchgewachsen<br />
sein." 86<br />
Die Entwicklung fester Handelsformen für den Gemeinschaftsabsatz (erst als Zusammenschluß<br />
zu örtlichen Erzeugervereinen, dann zu Regionalverbänden), Anbau- und Lieferverträge<br />
zwischen Gemüseerzeugern und Verwertungsindustrie und schließlich <strong>der</strong> Ausbau des<br />
Fernabsatzes unter den Bedingungen des Gemüsegroßhandels beschleunigten die<br />
Ausformulierung von Standardisierungsvorschriften. Auch von <strong>der</strong> Produktionsseite her<br />
wurde versucht, das Sortierungsschema mitzubestimmen. So verfügte die Landwirtschaftskammer<br />
für die Provinz Schleswig-Holstein mit <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> "Kohlmarke" 1928 eine<br />
obligatorische Regelung über die Größensortierung in vier Klassen nach dem Gewicht.<br />
Weiterhin war darin erstmals in Deutschland ein wichtiges Element <strong>der</strong> Standardisierung<br />
verwirklicht: die Sorteneinschränkung: Für Weiß-, Rot- und Wirsingkohl waren nur je 4 bis 5<br />
Sorten zugelassen, die nach Ablauf <strong>der</strong> Übergangsbestimmungen sogar aus anerkanntem<br />
Saatgut stammen mussten 87 . Dass die Einführung <strong>der</strong> Standardkohlmarke ohne greifbaren<br />
Erfolg blieb, scheint daran gelegen zu haben, dass sie z.B. mit dem Ausschluss kleinerer<br />
Köpfe im Gewicht von 2 - 2,5 Pfund (die befriedigende Preise hätten erzielen können), an<br />
den Sortierungsschemata <strong>der</strong> Großmärkte vorbei ging. Denn die Definitionsmacht für die<br />
Standardisierungsvorschriften liegt beim Handel. Während die Reichseinheitsvorschriften für<br />
die Sortierung von Obst und Gemüse von 1942 lediglich Gewichtsklassen enthielten 88 ,<br />
nehmen sich die inexpliziten Handelsvorstellungen schon 1934 wesentlich genauer aus:<br />
86 ROSENBERGER, HANNA: Untersuchungen über die Entwicklung des Liegnitzer Gemüsehandels und<br />
<strong>der</strong> Rohkonservenindustrie, phil. Diss. Jena 1922 (Manuskript), zitiert nach KÄMPFER 1944: 22.<br />
87 Landwirtschafts-Kammer für die Provinz Schleswig-Holstein 1928; KÄMPFER 1944: 26.<br />
88 GOLTZ & STOLLE 1942; Übersichtstabellen bei KÄMPFER 1944: 31ff. Die älteste mir bekannten<br />
fruchtartübergreifenden Sortierungsvorschriften (von 1910) haben offenbar keine größere Beachtung<br />
gefunden. Sie bestimmten bei Kopfkohl über Gewichtsklassen hinaus für Qualität A: "Gesund, ausgereift,<br />
fest, <strong>der</strong> Sorte entsprechend gut in Form und Farbe (Gesamtlieferung in gleichmäßiger Form und<br />
Färbung, ohne Risse, Stoßflecke o<strong>der</strong> sonstige Verletzungen <strong>der</strong> Deckblätter, frei von Insektenfraß<br />
und Faulstellen, im Winter absolut frostfrei; am Strunk nicht zu kurz geschnitten, damit äußere Deckblätter<br />
noch festen Halt haben. Ab 1. Januar evtl. erste Deckblätter fehlend" (Arbeitsausschuß für<br />
Obst- und Gemüseabsatz 1910: 32).<br />
- 59 -